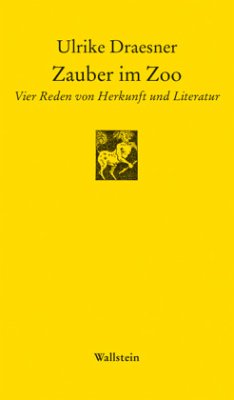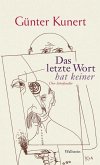Ulrike Draesner unterscheidet zwischen Mensch und Biene
"O mein Gott, wo sind die alten Bäume, unter denen wir noch gestern ruhten, die uralten Zeichen fester Grenzen, was ist damit geschehen, was geschieht?" Kein Globalisierungsgegner unserer Tage, sondern ein Romantiker der alten Schule stöhnt hier auf angesichts eines ungewiss werdenden Begriffs von Heimat: Achim von Arnims Sorge, dass die Wegmarken der eigenen Herkunft im "Wirbelwind des Neuen" verlorengingen, fand in den seither vergangenen zwei Jahrhunderten keinen befriedigenden Trost.
Kaum einer hat ihn so vehement spenden wollen wie Ludwig Ganghofer, dessen Hochlandromane in Blut-und-Boden-Verdacht gerieten und bleischwer in der deutschen Literaturgeschichte liegengeblieben sind. In den sechziger Jahren sollte sein Geist mit "Anti-Heimat-Romanen" ausgetrieben werden, die aber so monoton gerieten, dass der Markt schon in den achtziger Jahren wieder anfällig wurde für rurale Kitschlektüren. In letzter Zeit ist das Thema zum Gegenstand einer vielfältigen Entkrampfungspublizistik geworden.
Nun hat sich auch Ulrike Draesner in ihren Bamberger Poetik-Vorlesungen des Problems einer Verortung von Identität angenommen und es aus der Sicht der Dichterin reflektiert: "Literatur verhandelt, als wen oder was wir uns sprechend erfinden." Mit dieser Prämisse erklärt sie die Frage nach Heimat zum anthropologischen wie narrativen Grundmotiv: Herkunft, so Draesner, ist stets sprachlich verfasst, ist "immer Erzählung". Das unterscheide uns von den Bienen, die ihre Zugehörigkeit zu einem Stock per Geruchssinn erfassen könnten.
So nüchtern und naturwissenschaftlich das klingt, so persönlich werden Draesners Überlegungen, wenn es um das spezifische Heimaterlebnis ihrer Generation geht. In den Erzählungen der Großeltern sei Heimat als klar umrissener Begriff mit der traumatischen Erfahrung von Flucht und Vertreibung assoziiert gewesen, während sie die eigene Lokalisierung immer nur ex negativo vornehmen konnte: Weder der Osten der familiären Vergangenheit noch der Katholizismus ihrer Gegenwart schienen etwas mit ihrer Persönlichkeit zu tun zu haben.
Aus Gefühlen der Unbehaustheit heraus hat sich vor allem in der Dichtung des Exils, wie etwa bei Nelly Sachs, der Topos von der Sprache als Heimat herausgebildet. Doch der scheint Draesner nicht einleuchten zu wollen. Im Gegenteil: Als Poeta doctus hat sie so viel Deleuze, Foucault, Sloterdijk, Luhmann, Link und Assmann gelesen und so viel über modernes Nomadentum, "Wirklichkeitskurven", Beobachtung, Gedächtnis, Gentechnik und Hirnforschung erfahren, dass ihr vor lauter Unruhe der Erkenntnissuche allenfalls Wortspiele und Metaphern ein gedankliches Zuhause bescheren, aber eben immer nur für kurze Zeit.
Als Interpretin ihres eigenen Werks enthüllt sie motivische "GeHEIMnisse" eines Textes, als Autobiographin erinnert sie sich an die inspirierende Kraft von Lamaspucke, und als Philologin erklärt sie Odysseus zum Vorbild. Das wirkt bei aller intellektuellen Anregung so gehetzt, als wollte sie allen Arnim-Anhängern klarmachen: Eure alten Bäume sind längst zu Pressspanplatten verarbeitet worden. Das ist gleichwohl mehr als eine Ikea-Poetik.
ROMAN LUCKSCHEITER
Ulrike Draesner: "Zauber im Zoo". Vier Reden von Herkunft und Literatur. Wallstein Verlag, Göttingen 2007. 111 S., br., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH