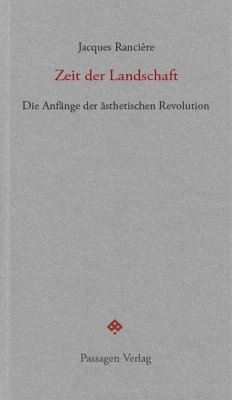Im Jahre 1790 erhob Immanuel Kant die Gartenkunst in den Rang der schönen Künste. Im selben Jahr erblickte William Wordsworth in der französischen Landschaft die Zeichen der künftigen Freiheit und Gleichheit des Menschen, während Edmund Burke den Revolutionären vorwarf, sie zwängen der Gesellschaft die steife, autoritäre Ordnung der französischen Gärten auf. Jacques Rancière zeigt uns, dass die Landschaft mehr ist als ein beeindruckendes Schauspiel für das Auge oder die Seele. Er geht den ästhetischen Debatten und Kontroversen nach, die im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einer radikalen Veränderung Kunstbegriffs und der Kriterien des Schönen geführt haben. Dabei wird deutlich, dass diese Revolution nicht nur die Normen der Kunst und der Gesellschaft betrifft, sondern auch die Formen der sinnlichen Erfahrung selbst.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Rezensent Christoph Paret lernt Erstaunliches in Jacques Rancières "Zeit der Landschaft": Im Gegensatz zu heute, wo wir die Instabilität der Natur anhand der immer bedrohlicheren Klimakrise bemerkten, war das 18. Jahrhundert eine Zeit, in der die ästhetische Erfahrung der Natur als Zeichen der Unendlichkeit verstanden wurde. Der Philosoph Rancière zeige, wie auch schon in vorherigen Werken, eine Querverbindung von Ästhetik und Gesellschaft auf. In der Malerei gibt es, wie den Rezensenten überrascht, den Kunstgriff, die Landschaft unendlich erscheinen zu lassen, was auch neue Räume des Geistigen, der Gedanken und Überlegungen ermögliche. Dies sei politisch nicht unbedeutend, erlaube es doch Vorstellung, dass auch das einfache Volk in der Kunst auftauchen könne. Ganz so einfach übertragbar sei es aber leider nicht, liest Paret, die Spannung dazwischen, auf dem Bild zu erscheinen und wirklich aktiv gesellschaftlich teilzuhaben, bleibe erhalten. "Brillant", resümiert der Rezensent seine Lektüre.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH