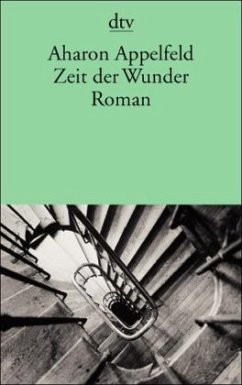Österreich 1938. Der 12-jährige Bruno kehrt aus den Ferien zurück. Da stoppt der Zug auf freier Strecke: Alle Ausländer und Nichtchristen müssen sich registrieren lassen; erste Anzeichen des heraufziehenden Unheils. Nur Brunos Vater, ein gefeierter jüdisch-österreichischer Autor, sucht noch nach Erklärungen. Als sich alle immer deutlicher gegen sie wenden, übernimmt er sogar anitsemitische Positionen...
"Es gibt niemanden, der die Krise der europäischen Zivilisation vor und nach dem Zweiten Weltkrieg eindringlicher darstellen könnte als Aharon Appelfeld." New York Times Book Review
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Nicht als "plötzliches Glück", sondern als blanke "Fassungslosigkeit" sei das "Wunder" in Aharon Appelfelds Titel zu verstehen, erklärt der Rezensent Paul Jandl. Dieser 1978 erstmals erschienene Roman, der aus der Perspektive eines "genau beobachtenden Kindes" die "subtilen Veränderungen" in einem zunehmend antisemitischen, fiktiv-konkreten Österreich schildere, mache das "Jüdische" zum Thema und zur Frage. Voller Bewunderung beschreibt Jandl, wie Appelfeld das spätere Trauma als "unruhigen Schlaf" beginnen lasse, "in den Albträume einfallen", und die Ereignisse in eine "Nacht" zu tauchen, die auch symbolisch als "Umnachtung" zu verstehen sei. Überhaupt sei Appelfelds "durch strenge Symbolik disziplinierter" Roman ein Meisterwerk der bedeutsamen Verknüpfung. Auch "Kafka-ähnliche Motive" habe Appelfeld "virtuos" eingearbeitet und einen Text geschaffen, "der die Evokationen des Ausgeliefertseins zum eindringlichen Bild verdichtet". Bemerkenswert findet Jandl, dass Appelfeld die Frage nach der "prinzipielle Identität der Juden" stellt, ohne auf das Täter-Opfer-Schema zurückzugreifen, sondern "mit aller Wucht des Paradoxen". All das mache "Zeit der Wunder" zu einer "zeitlosen Vision vom Untergang der europäischen Zivilisation".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Eine zeitlose Vision vom Untergang der europäischen Zivilisation. Neue Zürcher Zeitung