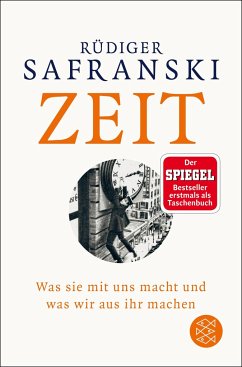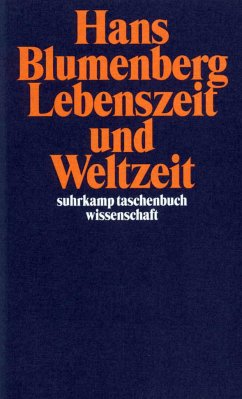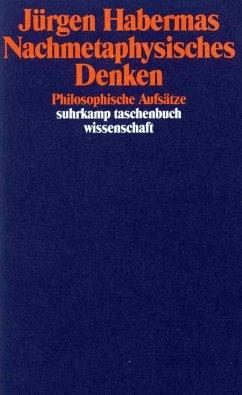Zeit
Was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
16,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Rüdiger Safranski hat mit seinem Bestseller »Zeit. Was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen« eine reflektierte und philosophische Anleitung für den Umgang mit Zeit vorgelegt. In einem Querschnitt durch verschiedene Epochen von Dichtern und Denkern beschreibt Rüdiger Safranski das Spannungsfeld zwischen Vergehen und Beharren und ermuntert uns, in unserem schnelllebigen Alltag das wertvolle Gut Zeit zu schätzen und behutsam mit ihm umzugehen.»Dieses Buch ragt über alles hinaus, was heute über den Umgang mit Zeit auf dem Markt ist. Mit Genuss lesbar! Ein Sachbuch, das zaubern kan...
Rüdiger Safranski hat mit seinem Bestseller »Zeit. Was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen« eine reflektierte und philosophische Anleitung für den Umgang mit Zeit vorgelegt.
In einem Querschnitt durch verschiedene Epochen von Dichtern und Denkern beschreibt Rüdiger Safranski das Spannungsfeld zwischen Vergehen und Beharren und ermuntert uns, in unserem schnelllebigen Alltag das wertvolle Gut Zeit zu schätzen und behutsam mit ihm umzugehen.
»Dieses Buch ragt über alles hinaus, was heute über den Umgang mit Zeit auf dem Markt ist. Mit Genuss lesbar! Ein Sachbuch, das zaubern kann.« Sten Nadolny, Focus
In einem Querschnitt durch verschiedene Epochen von Dichtern und Denkern beschreibt Rüdiger Safranski das Spannungsfeld zwischen Vergehen und Beharren und ermuntert uns, in unserem schnelllebigen Alltag das wertvolle Gut Zeit zu schätzen und behutsam mit ihm umzugehen.
»Dieses Buch ragt über alles hinaus, was heute über den Umgang mit Zeit auf dem Markt ist. Mit Genuss lesbar! Ein Sachbuch, das zaubern kann.« Sten Nadolny, Focus