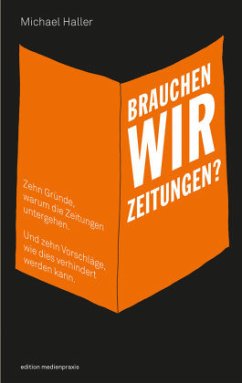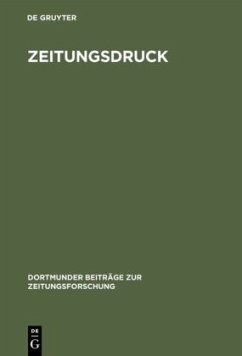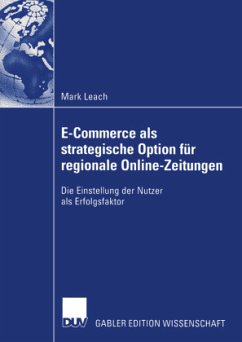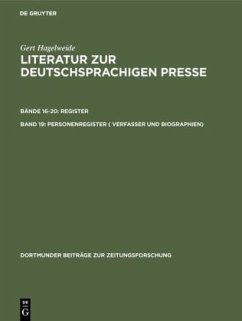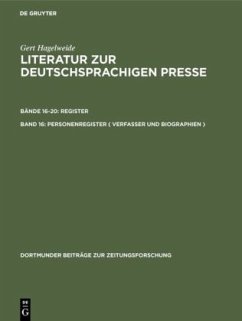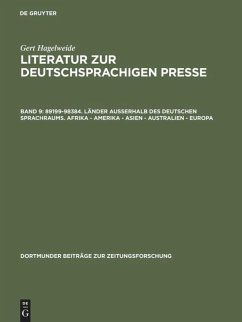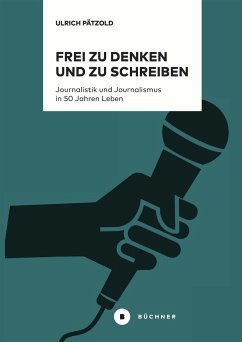Nicht lieferbar
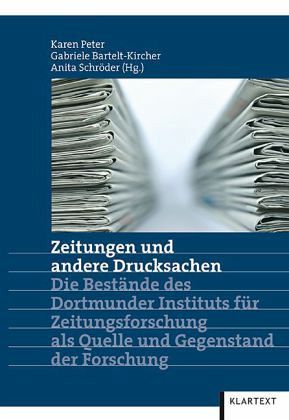
Zeitungen und andere Drucksachen
Die Bestände des Dortmunder Instituts für Zeitungsforschung als Quelle und Gegenstand der Forschung
Herausgegeben: Peter, Karen; Schröder, Anita; Bartelt-Kircher, Gabriele
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Die Beiträge der Festschrift für Gabriele Toepser-Ziegert beschäftigen sich mit dem Dortmunder Institut für Zeitungsforschung und seinen Forschungsgebieten