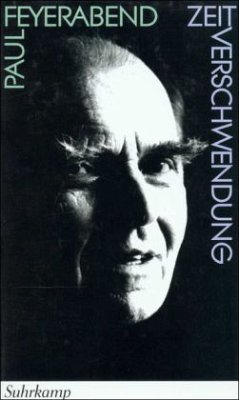Es hätte nicht viel gefehlt, und Paul K. Feyerabend wäre Opernsänger geworden. Eine solide Gesangsausbildung hat er jedenfalls genossen, und dem Musiktheater galt seine Leidenschaft mindestens ebensosehr wie der Wissenschaftstheorie, in der er berühmt geworden ist mit dem Satz: Anything goes. Auch wenn ihm die Universität "ein beachtliches Einkommen" und zudem die Möglichkeit bot, seinem Hang zum Geschichtenerzählen nachzugehen, empfand er die Wissenschaft nicht als Mittelpunkt seines Lebens. Deshalb ist dieses Buch auch keine "intellektuelle Autobiographie", die den normativen Ansprüchen einer philosophischen Vernunft an die Wissenschaftsentwicklung noch einmal den Prozeß machte, um am Schluß das Urteil zu fällen, alles sei möglich. Gewiß, Feyerabend gefällt sich als Elefant im Porzellanladen der popperianischen Forschungslogik. Viel lieber aber und mit Akribie erinnert er sich über Jahrzehnte hinweg an eine Vielzahl von Theateraufführungen und an die Leistungen einzelner Schauspieler und Sänger. Feyerabend hat dieses Buch 1993, im letzten Jahr seines Lebens, geschrieben. Zu Beginn wußte er noch nicht, daß ihn nach Abschluß des Manuskripts der Tod erwartete. Fast ohne Dokumente, nahezu ausschließlich auf die Erinnerung gestützt, blickt er ein wenig verwundert auf ein Leben zurück, das ihm - trotz der Turbulenz der äußeren Ereignisse - manchmal leer erscheint, in dem er jedenfalls zuviel Zeit für unwichtige Dinge verschwendet habe. Ihn selbst irritiert das eigentümliche Gefühl des unbeteiligten Staunens, mit dem er nicht nur als Kind die Skurrilitäten und Grausamkeiten der Welt wahrgenommen habe. Nichts schien haftengeblieben von der Enge einer kleinbürgerlichen Kindheit in Wien oder von den Kriegserfahrungen als Offizier der großdeutschen Wehrmacht. Der Krieg erschien dem Oberschüler "mehr als Unannehmlichkeit denn als moralisches Problem". Schon damals bemerkt er an sich als zentralen Charakterzug die "Neigung, seltsame Meinungen zu übernehmen und auf die Spitze zu treiben".

Paul Feyerabends Erinnerungen / Von Stephan Speicher
Dies ist nun, mit dem Autor zu sprechen, die letzte der gedruckten Ausschweifungen, die der Suhrkamp Verlag unbedingt auf den Markt werfen mußte. "Zeitverschwendung", die Lebenserinnerungen des Philosophen und Wissenschaftstheoretikers Paul Feyerabend, erschein postum, ein gutes Jahr nach seinem Tod im Februar 1994. Es ist ein uneinheitliches, in Partien geradezu schwaches, dann wieder sehr eindrucksvolles Buch. Eine intellektuelle Biographie, einen Rechenschaftsbericht über die Geschichte seiner Gedanken wie von Rudolf Carnap etwa darf man nicht erwarten. Das Buch ist persönlich - wie könnte es anders sein bei diesem Autor, dessen lebenslange Passion es war, Mißtrauen gegen Aussagen mit allgemeinem Wahrheitsanspruch zu wecken.
Daß die Entscheidung für eine Philosophie davon abhänge, was für ein Mensch man sei, ist keine neue Erkenntnis. Aber für kaum jemanden ist sie so unmittelbar einleuchtend wie für Feyerabend und seine Leser. Und deshalb wird es zumindest diese interessieren, wie der Autor die Frage seines Lebens stellt: "Wie kam es dazu, daß ich als eine Art Intellektueller endete, sogar als Professor, mit einem ansehnlichen Gehalt, einer zweifelhaften Reputation und einer wunderbaren Frau?"
Nahezu jede Autobiographie hat ihre stärksten Momente auf den ersten Seiten, bei Kindheit und Jugend, und oft gehört sogar die Beschreibung der Vorfahren noch dazu. Vermutlich liegt es an der ungeschützten Wahrnehmung der frühen Jahre. Ohne Konkurrenz durch frühere Erlebnisse, ohne begrifflich-theoretische Einordnung treffen die Ereignisse auf die Kinder; der geistige Apparat, der nachher solche Ereignisse abhält, umlenkt, befriedet, ist noch schwach entwickelt. Etwas von diesem Seelenleben ohne Imprägnierung bewahrt jede gute Lebenserinnerung. Feyerabends Familie muß den unimprägnierten Jungen mit einer Fülle von Absonderlichkeiten überschüttet haben.
Ein Raritätenkabinett von Verwandten umgab ihn, keiner reich, angesehen oder gebildet, aber jeder und jede mit einem höchst eigenen Schicksal. "Zwei unglückliche Menschen, durch Zufälle und enttäuschte Hoffnungen aneinandergekettet", heißt es von seiner Cousine Emma und ihrem Mann Bautzi Bartunek, aber es galt entsprechend wohl auch für andere. Das Wiener Kleinbürgertum taucht auf, musikalisch und auch weniger fein, vor allem aber raunzend, Zeuge des Zusammenbruchs eines alten Reiches, mit den forcierten Eigenwilligkeiten, wie Doderer sie beschrieben hat. Kein Milieu jedenfalls, eine einheitliche Vorstellung von der Welt nahezulegen.
Da war zum Beispiel Onkel Kaspar. ",Disziplin ist gut für die Seele', sagte er und schlug mich." Danach ist man allerdings jedem Methodenzwang abgeneigt. Eine zweite Erfahrung, die der kleine Paul bei seiner Tante auf dem Land machte, und auf dem Weg zum Professor Feyerabend ist schon ein gutes Stück geschafft: "Hin und wieder betrat ich den Hühnerstall, schloß die Tür hinter mir und hielt eine Ansprache an die Insassen, eine exzellente Vorbereitung für meinen späteren Beruf." Was den Autor auf sein Interesse für Physik und besonders Astronomie wie für Philosophie brachte, erfahren wir dagegen nur undeutlich. Das Buch ist sehr episodisch und sprunghaft. Wer will, kann das einem Grundzug des Feyerabendschen Denkens zuschreiben. Der Wunsch, die eigene Lebensgeschichte nicht als ein beständiges Fortschreiten von kleineren zu immer größeren Erfolgen zu fassen, hat natürlich eine Wahrheit. Aber daß ein Leben, auch ein wissenschaftliches Leben wie das Feyerabends, neben Brüchen und Turbulenzen durchgehende Linien hat, an denen man die Schriften des Autors selbst dann erkennen würde, wenn der Name nicht auf dem Titelblatt stünde, das kommt zu kurz.
Nach der Matura 1942 wurde Feyerabend erst zum Arbeitsdienst, dann zur Wehrmacht eingezogen. So bewegend die Szenen der Kindheit sind, so kühl wirken die Reminiszenzen aus Nationalsozialismus und Krieg: Im Schlamm entlud sich die Pistole eines Kameraden, dem "das Blut in einer perfekten Parabelkurve aus seinem Körper hervorschoß". Zweimal sah er, wie deutsche Soldaten Zivilisten ermordeten. Seine Notiz dazu: "Diese Ereignisse schockierten mich nicht, dafür waren sie viel zu seltsam. Aber ich habe sie behalten, und wenn ich heute daran denke, schaudert es mich." Auch die Nachkriegszeit, in der sich der allmähliche und dann immer raschere Aufstieg Feyerabends vollzog, will nicht so recht deutlich werden. Die Hochschulwelten, die er durchkreuzte, Wien, die Zeit bei Popper in London, Bristol, dann Kalifornien, Berlin, Kassel und zuletzt Zürich, sehen sich recht ähnlich. Allerhand Prominenz taucht auf, huscht über die Seiten und verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen. Selbst die zugegeben kurzen Begegnungen mit Niels Bohr und Ludwig Wittgenstein vergißt man bald.
Dabei ist das alles nicht einmal unsympathisch. Der Autor redet sich nicht schön, er versucht weder Bewunderung noch Zuneigung zu ernten. Der flinke, selbstironische Stil ist durchaus geeignet, den Leser bei der Stange zu halten. Doch es herrscht der Eindruck eines Mangels vor. Gewiß liegt das an den Umständen der Entstehung. Das Manuskript ist die Arbeit eines Krebskranken, der Tod hat offenbar eine gründlichere Durchsicht vereitelt. Doch das allein ist's wohl nicht. Ins Spiel kommt auch eine humane Schwäche, über die Feyerabend selbst spricht. Dieser Mann hat viel Unglück gesehen. Seine Mutter litt unter Depressionen. Noch als ihr Kind ein kleiner Junge war, unternahm sie einen ersten Selbstmordversuch, später brachte sie sich um. Der Vater endete nicht ganz so grausam, aber lebte früh wohl auch im Gefühl einer gescheiterten Existenz. Und Feyerabend selbst wurde im Krieg schwer verwundet.
Das trug ihm eine schwere Gehbehinderung, dauernde Schmerzen und Impotenz ein, worüber er in offenem, aber festem und respektgebietendem Ton spricht. Erst nach vielen Jahren, so berichtet er, gewann er ein Verhältnis zu dem Kummer seiner Eltern. Als er in Kalifornien von der letzten Krankheit seines Vaters hörte, rührte er sich nicht, kam auch nicht zur Beerdigung nach Wien. Später, so schreibt er, erschien ihm sein Vater in seinen Träumen, bis der Sohn versuchte, seinem Gefühl Ausdruck zu verleihen: "Es tut mir leid, daß ich immer so ein Egoist gewesen bin."
Es ist eine merkwürdige und beunruhigende Vorstellung, daß jener Mann, der gegen die Autoritäten eines falschen Universalismus zu Felde zog, der die dogmatische Auffassung von der Geltung der Wissenschaft und Vernunft bekämpfte, der dagegen das Recht von common sense, Lokalvernunft und Mitmenschlichkeit stellte, über lange Zeit kaum imstande war, zu seiner persönlichen Umgebung in ein substantielles Verhältnis zu kommen. Die Selbstzerknirschung, die uns vorgestellt wird, schreibt ein Sterbender nieder, das muß man berücksichtigen und berücksichtigen auch, daß seine letzte Frau, Grazia Borrini, ihm als der Engel seiner Existenz erschien und so wächst, wie er sich als geschrumpft darstellt.
Und doch will es passen, daß er, der Fliegende Holländer der Wissenschaftstheorie, der Schrecken aller frommen Forscher, seine methodologischen Kühnheiten auf einem Substrat seelischer Unordnung kreisen ließ: "Fast alle meine Handlungen waren vorläufig, unfertig und ohne ein allgemeines Ziel." Immer wieder ist von dieser Unsicherheit, fast Haltlosigkeit die Rede. Doch sind die Bereitschaft, den Kanon von Einsichten und Verhaltensweisen einmal von außen zu inspizieren, sind Freimut, Unbefangenheit, geistige Risikofreude Eigenschaften, die der Haltlosigkeit benachbart sind. Die Denkbeamten aller Schulen sind davor natürlich gefeit. Zuletzt versucht der Lebensrückblick, einige der Provokationen zurückzunehmen, nicht ganz glücklich. Daß sich der Gedanke des kulturellen Relativismus, wie manche andere seiner "Schreibtischweisheiten", nicht so gut gehalten habe, wird nur noch matt begründet, indem nun alle Kulturen als lediglich "wandelbare Ausdrucksformen einer einzigen menschlichen Natur" gelten sollen.
Wenn bei allen erkennbaren Mängeln "Zeitverschwendung" doch ein Eindruck genannt werden darf, so weil das Buch ein Gefühl von Wahrhaftigkeit vermittelt. Es hat sich jemand um Erkenntnis bemüht, der von den Ausdrücken "Wahrheit" und "Vernunft" nicht viel hielt. Nicht weil er das Ziel nicht schätzte, sondern weil er die damit verbundenen Kosten hoch veranschlagte und die Sicherheit, mit der diese Worte verwendet wurden, für hochstaplerisch hielt. Sein Angriff auf den Kanon der Selbstverständlichkeiten hat keinen neuen Kanon gestiftet. Den Vertretern politischer Korrektheiten war er ein unsicherer Kantonist. Und zuletzt sind einem die Philosophen am liebsten, die einem sagen: "Hören Sie, wir wissen es auch nicht, wir müssen abwarten."
Paul Feyerabend: "Zeitverschwendung". Übersetzt von Joachim Jung. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1995. 250 S., geb., 38,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main