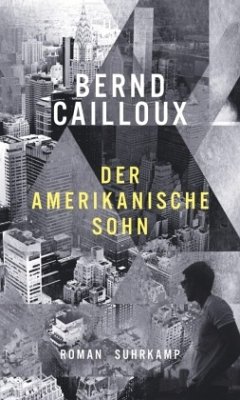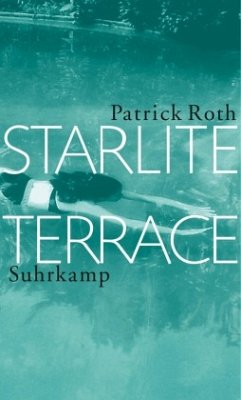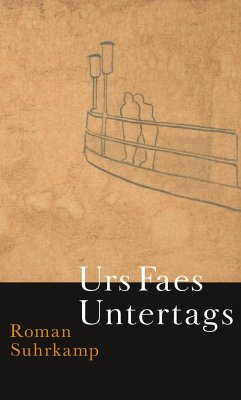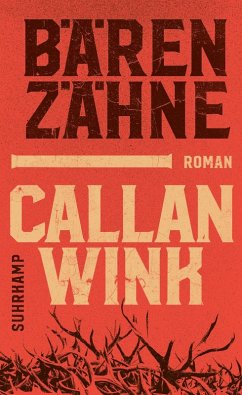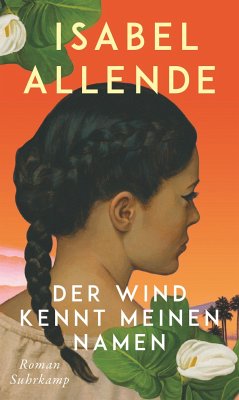Zerbrechlichkeit oder Die Toten der Place Baudoyer
Roman
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
19,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Für manche Menschen ist jede Zeit eine Zeit der Gefahr, in der das Leben intensiver wird, sich konzentriert auf den gegenwärtigen Augenblick, das Jetzt. Lebenshunger zeichnet sie aus und eine Unersättlichkeit, der fast alles geopfert wird.Stein, österreicher in Kalifornien, der zwischen Neuer und Alter Welt pendelt, ist einer dieser ängstlich Verwegenen. Er lädt Stéphane, seinen Freund aus Pariser Studententagen, zu dessen fünfzigstem Geburtstag an die Westküste ein. Ihr einwöchiges Zusammensein wird zu einer Fahrt ins Blaue, einem Erinnerungs- und Bilanztrip, der sie zuletzt in das ...
Für manche Menschen ist jede Zeit eine Zeit der Gefahr, in der das Leben intensiver wird, sich konzentriert auf den gegenwärtigen Augenblick, das Jetzt. Lebenshunger zeichnet sie aus und eine Unersättlichkeit, der fast alles geopfert wird.
Stein, österreicher in Kalifornien, der zwischen Neuer und Alter Welt pendelt, ist einer dieser ängstlich Verwegenen. Er lädt Stéphane, seinen Freund aus Pariser Studententagen, zu dessen fünfzigstem Geburtstag an die Westküste ein. Ihr einwöchiges Zusammensein wird zu einer Fahrt ins Blaue, einem Erinnerungs- und Bilanztrip, der sie zuletzt in das Kasino Viejas führt. Stéphane schreibt dort einen Brief an die verlorenen Menschen seines Lebens, in dem er jede Untreue und Herzlosigkeit einräumt und sich für nichts entschuldigt. Die Freunde, die außer der Vergangenheit und ihrem Hunger nicht viel verbindet, sprechen einander Mut zu. Vieles war falsch, aber die Fahrt der zwei schrägen Vögel Richtung Hölle geht weiter.
Einmal in Paris, genau dort, wo Stein vor nicht allzu langer Zeit mit der jungen Sophie, die »reine Zerbrechlichkeit« war, in einem endlos langen Kuß vereint gestanden hatte, stürzten bei Erdarbeiten Särge und Skelette ans Licht. »Wer waren die Toten der Place Baudoyer?« wunderte sich Stein. »Er ergriff Sophies Hand, und sie verließen die gaffende Menge. Festlichkeit erfüllte ihn.« »Denn diese Toten, sie sprechen zu ihm: Kümmere dich, jetzt ist die Zeit zu leben.«
Kindlich genug, fragt ein nicht mehr junger Mann, warum die Welt nicht so ist, wie er sie haben will. Rastlos fliegt Stein zwischen Amerika und Europa hin und her. Hellwach, aber unbelehrbar folgt er seiner Augenblickslust, die, wie bekannt, Ewigkeit will, in jedes neue Abenteuer. Bis der Besuch eines Freundes aus Paris ihn zum Stocken bringt.
Stein, österreicher in Kalifornien, der zwischen Neuer und Alter Welt pendelt, ist einer dieser ängstlich Verwegenen. Er lädt Stéphane, seinen Freund aus Pariser Studententagen, zu dessen fünfzigstem Geburtstag an die Westküste ein. Ihr einwöchiges Zusammensein wird zu einer Fahrt ins Blaue, einem Erinnerungs- und Bilanztrip, der sie zuletzt in das Kasino Viejas führt. Stéphane schreibt dort einen Brief an die verlorenen Menschen seines Lebens, in dem er jede Untreue und Herzlosigkeit einräumt und sich für nichts entschuldigt. Die Freunde, die außer der Vergangenheit und ihrem Hunger nicht viel verbindet, sprechen einander Mut zu. Vieles war falsch, aber die Fahrt der zwei schrägen Vögel Richtung Hölle geht weiter.
Einmal in Paris, genau dort, wo Stein vor nicht allzu langer Zeit mit der jungen Sophie, die »reine Zerbrechlichkeit« war, in einem endlos langen Kuß vereint gestanden hatte, stürzten bei Erdarbeiten Särge und Skelette ans Licht. »Wer waren die Toten der Place Baudoyer?« wunderte sich Stein. »Er ergriff Sophies Hand, und sie verließen die gaffende Menge. Festlichkeit erfüllte ihn.« »Denn diese Toten, sie sprechen zu ihm: Kümmere dich, jetzt ist die Zeit zu leben.«
Kindlich genug, fragt ein nicht mehr junger Mann, warum die Welt nicht so ist, wie er sie haben will. Rastlos fliegt Stein zwischen Amerika und Europa hin und her. Hellwach, aber unbelehrbar folgt er seiner Augenblickslust, die, wie bekannt, Ewigkeit will, in jedes neue Abenteuer. Bis der Besuch eines Freundes aus Paris ihn zum Stocken bringt.