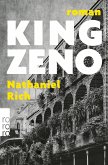Im August 2005 zerstört der Hurrikan Katharina die Stadt New Orleans. Am schlimmsten sind die Wohnbezirke der Schwarzen betroffen. Die Schullehrerin Zola Jackson weigert sich, trotz eindringlicher Warnungen und Auffordungen der Rettungsdienste die Häuser zu verlassen, ihr Heim aufzugeben. Zusammen mit ihrer Hündin Lady flüchtet sie sich unter den Dachstuhl und beginnt ihr Überleben zu organisieren.

Der Hurrikan "Katrina" traumatisierte New Orleans. Gilles Leroy spiegelt das Elend in einem ergreifenden Frauenschicksal.
Von Daniel Haas
Wenn die Zahlen überwältigend sind, hilft die Imagination. Vierundzwanzig Millionen Menschen waren im letzten Jahr von den Naturkatastrophen in Chile, Haiti und Pakistan betroffen. Die Zahl hat bestürzende und zugleich sedierende Wirkung, man kommt solchen Statistiken kaum mehr mit Berichten und Bildern bei. Es werden, selbst bei größter journalistischer Anstrengung, am Ende doch die immer gleichen Motive von verwüsteten Landstrichen, Notunterkünften und erschöpften Obdachlosen sein. Die Literatur präpariert unter diesem Firnis des Gleichen die besonderen Formen des Leids, der Tragik, auch der Schuld heraus. Insofern ist "Zola Jackson", der Roman von Gilles Leroy, die nachgereichte Inspektion einer Jahrhundertkatastrophe.
Was in New Orleans in jenem August 2005 geschah, ist bekannt: Die Dämme brachen, die Stadt versank in den Fluten, mehr als 1500 Menschen kamen um. Aber begreifen wir deshalb diese Tragödie? Der Goncourt-Preisträger Leroy entwirft für uns ein mögliches Schicksal, in dem sich entscheidende Fragen unter dem Brennglas der Emphase und der politischen Kritik in furioser Weise bündeln: Wie viel Natur steckte in dieser Katastrophe, und wie sehr war sie auch ein politischer Gau? Was hat sie mit den sozialen Realitäten von Rasse und Klasse zu tun?
Zola Jackson, die Titelheldin, ist eine etwa sechzigjährige Afroamerikanerin, die im Sommer 2005 in ihrem Haus die Stellung hält. Nur ihr Hund ist ihr geblieben, die Nachbarn, die Freunde, die Verwandten - alle sind geflüchtet oder den Fluten zum Opfer gefallen. Leroy nutzt ein Motiv der Westerndramaturgie - das Sichverschanzen in einer Wagenburg gegen den anstürmenden Feind - und variiert es mit böser Ironie: Denn nun sind die Eindringlinge die Bergungsteams, die viel zu spät anrücken, oder Prominente wie der Filmstar Sean Penn, der als Galionsfigur der Hollywood-Gutmenschen unbedingt Leben retten möchte.
Nothilfe als PR-Aktion und Quotenbringer: Zola Jackson registriert das alles mit Lakonie, sie ist keine zeternde Moralistin, sondern Chronistin einer historisch herleitbaren Unrechtsgeschichte. Als Überlebende der Flut von 1969 kann sie die Arroganz der Regierung nicht mehr überraschen. Damals hatte man die Deiche im Osten der Stadt gesprengt, damit sich das Wasser in die Viertel der Armen ergoss. Jetzt entsendet man Helikopter, aber nicht, um die Ertrinkenden zu retten, sondern, um sie zu filmen für das nächste Nachrichten-Update im Fernsehen. "Für sie sind wir die barbarische Stadt geblieben", erklärt Jackson die Indifferenz der Regierung, "die Stadt, die nicht Englisch lernen wollte, die nie Geschmack am Puritanismus finden wird, die sich mit den Indianern verbündete und wie diese die Flussgeister des Mississippi verehrte."
Gäbe es nur dieses grimmige Räsonieren, dann wäre der Roman ein erweitertes Thesenpapier zu jener amerikanischen Studie, die ein Jahr nach "Katrina" den Behörden "Versagen vor den feierlichsten Verpflichtungen zum Schutz des Gemeinwohls" bescheinigte. Aber das Buch gibt der Misere Tiefenschärfe und spiegelt sie in der Biographie seiner Erzählerin: wie sie ihren Sohn Caryl großzieht, der seinen Vater, einen Weißen, nie kennenlernt. Wie sich dieser Junge als akademisches Genie entpuppt und zum Entsetzen der Mutter nicht Professor in Yale, sondern einfacher Lehrer in Atlanta werden will. Und wie er Troy nach Hause bringt, seinen Liebhaber und späteren Lebenspartner, ausgerechnet einen Weißen, der glaubt, man könne eine schwarze Mutter mit Küchengeräten becircen.
Zola wandert in den Reminiszenzen umher wie in dem sich mit Wasser füllenden Haus. Und während die Fluten sie und ihren Hund immer höher treiben, bis unters Dach, wo sie beinahe sterben, sinkt sie tiefer und tiefer in die Schichten ihrer Erinnerung, bis dorthin, wo das größte Elend bewahrt ist: der Krebstod des Sohnes.Von diesem Verlust her erschließt sich die Abgebrühtheit der Heldin noch einmal anders: Die Welt ist schon untergegangen, alles Weitere ist nur das maschinelle Abarbeiten von Lebenszeit. Und deshalb mündet die Todesnähe dieser Frau in eine Geburt. Man darf das Ende des ergreifenden Buchs nicht verraten. Aber dass der Text eine Art der Versöhnung entwirft, die den Kummer nicht verdrängt, sondern auf mehrere Schultern verteilt, dass muss festgehalten werden - gerade im Angesicht einer Gesellschaft, die vom Strom der Zerstörung fortgerissen wird.
Gilles Leroy: "Zola Jackson". Roman.
Aus dem Französischen von Xenia Osthelder. Kein & Aber Verlag, Zürich 2011. 176 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main