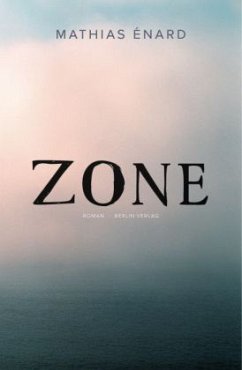Francis Mirkovic, alias Yves Deroy, sitzt im Pendolino von Mailand nach Rom, inkognito und erster Klasse reisend, und über ihm, mit einer Handschelle an der Gepäckstange gesichert, ein Metallkoffer voller Dokumente und Fotos - der Koffer voller Toten". Er enthält die Listen von Kriegsverbrechern, Waffenhändlern und Terroristen, die Francis als Agent des französischen Geheimdienstes in den Konfliktzonen des Mittelmeerraums zusammengestellt hat und an den Vatikan verkaufen will, um ein neues Leben zu beginnen.
Erschöpft von Alkohol und Amphetaminen lässt er seinen Erinnerungen freien Lauf - an die Entsetzlichkeiten des Balkankrieges, in die er zwei Jahre als Söldner verwickelt war, an die Freunde, die neben ihm starben, an die Menschen von Algier bis Jerusalem, die er ausspionierte, an die Frauen, die er liebte: Stéphanie, die kein Kind mit einem Barbaren wie ihm" wollte, oder Sashka, die vielleicht noch in Rom auf ihn wartet.
In einem einzigen Satz des symphonisch gestalteten inneren Monologs, im Stakkato des Nachtzugs, mäandernd, sich wiederholend, springt der Erzähler von Ereignis zu Ereignis - vom Blutbad der christlichen Phalange in Beirut 1982 zu Mussolinis Nordafrikakrieg, vom Den Haager Kriegsverbrecherprozess zu seinem Vater, der auf französischer Seite im Algerienkrieg folterte -, benennt die Gräuel aus der Geschichte und Gegenwart des Mittelmeers, die sich zu einem homerischen Fresko der Gewalt formen. Mit seinem Roman Zone erweist der junge Autor Énard einem Epos über den Krieg Reverenz, das zur Gründungsakte der europäischen Literatur wurde: Homers Ilias.
Erschöpft von Alkohol und Amphetaminen lässt er seinen Erinnerungen freien Lauf - an die Entsetzlichkeiten des Balkankrieges, in die er zwei Jahre als Söldner verwickelt war, an die Freunde, die neben ihm starben, an die Menschen von Algier bis Jerusalem, die er ausspionierte, an die Frauen, die er liebte: Stéphanie, die kein Kind mit einem Barbaren wie ihm" wollte, oder Sashka, die vielleicht noch in Rom auf ihn wartet.
In einem einzigen Satz des symphonisch gestalteten inneren Monologs, im Stakkato des Nachtzugs, mäandernd, sich wiederholend, springt der Erzähler von Ereignis zu Ereignis - vom Blutbad der christlichen Phalange in Beirut 1982 zu Mussolinis Nordafrikakrieg, vom Den Haager Kriegsverbrecherprozess zu seinem Vater, der auf französischer Seite im Algerienkrieg folterte -, benennt die Gräuel aus der Geschichte und Gegenwart des Mittelmeers, die sich zu einem homerischen Fresko der Gewalt formen. Mit seinem Roman Zone erweist der junge Autor Énard einem Epos über den Krieg Reverenz, das zur Gründungsakte der europäischen Literatur wurde: Homers Ilias.

Die Barbarei der Moderne lässt sich immer noch am besten mit den Mythen der Antike fassen: Der Franzose Mathias Énard hat ein Kriegsepos von größter Wucht geschrieben.
Von Katharina Teutsch
Fast wäre es einem bei der eigenen Odyssee durch die Neuerscheinungen des Bücherherbstes gar nicht aufgefallen: Gleich zwei Autoren, der eine dies-, der andere jenseits des Rheins, haben sich mit der Wiederbelebung antiker Stoffe hervorgetan und homerische Schlachtengemälde geschaffen, von denen man sich jetzt, zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts, fragen muss, ob es sich um kühne Erneuerungsgesten auf den Ruinen der europäischen Schriftkultur handelt oder doch nur um plumpe Versuche, eine moderne Globalisierungsstory mit reichlich viel weltliterarischem Talmi zu schmücken.
Der Deutsche Thomas Lehr bezieht sich in "September. Fata Morgana", einem Roman über den 11. September, explizit auf die homerischen Hexameter, welche ihm zu einem prosaischen Langgedicht von einiger Eindrücklichkeit verholfen haben. Nicht allen Rezensenten wollte Lehrs anachronistische Formensprache vollends einleuchten. In der Tat: Dort, wo der Autor unter Verzicht auf sämtliche Satzzeichen dem Denken keine Wegmarken setzt, ist der Leser zu permanenter Wachsamkeit verpflichtet. Die Freiheit von der Interpunktion allein verhilft indessen keineswegs zwangsläufig jedem Intellekt zu größerer Entfaltung. Aber ist es nicht dies, was wir von guter Literatur erwarten? Dass sie uns, die wir lesend ergründen, zur Expedition anleitet?
Nun erreicht uns aus Frankreich ein weiteres Experiment. Auf knapp sechshundert Seiten entfaltet Mathias Énard ein Fresko in vierundzwanzig und nicht nur hierin an die Ilias erinnernden Kapiteln, die gleich einen dreifachen Anspruch erfüllen: enorme stoffliche Verdichtung bei maximaler Entgrenzung der Form und höchstem ästhetischem Reiz. Énard nimmt uns, anders als Lehr, nur den Punkt zwischen den Sätzen. Das ist erträglich und hat seinen Sinn, denn der Ich-Erzähler, ein wütender Achill, befindet sich auf einer Zugreise: ein endloses Durchqueren von Landschaften, ein Aufrufen von Erinnerungen an ein dem Krieg und damit dem Tod geweihtes Leben. Tausendfünfhundert Kilometer zwischen Paris und Rom: Als die Handlung einsetzt, sind es ab Mailand noch fünfhundert Kilometer, die der Sohn einer kroatischen Patriotin und eines Algerienveterans zurückzulegen hat. Insgesamt neun Bahnhöfe gilt es zwischen Mailand und Rom zu passieren. Neun Bahnhöfe, die unverkennbar auch die Pforten zu den neun Höllenkreisen Dantes markieren.
Was hier nach maßloser Selbstüberhebung klingt, ist ein dezent abgemischter Chor der Gefallenen, begleitet vom Chor der Literaten, auf die sich Énard auf eine Weise bezieht, dass man der Literatur als welterschließender Kraft habhaft wird wie lange nicht. Joyce klingt an, der im Triester Nachtleben nach literarisch verwertbaren Abgründen sucht; William Burroughs, der in Tanger auf dem schmalen Grat zwischen sexueller Lust und Todessehnsucht experimentiert; Malcolm Lowry, der am Fuße des Vesuv beinahe die eigene Ehefrau stranguliert.
Wohin zieht es unseren Reisenden? Einen Aktenkoffer hat der ehemalige Söldner der kroatischen Nationalgarde, aufgerieben von Speed und Alkohol, an das Gepäcknetz gebunden. Darin befinden sich Disketten mit Personalakten von "Vergewaltigern", "Henkern", "Menschenfressern", die Francis Mirkovic in jahrelanger Kärrnerarbeit gesammelt hat und nun dem "für die Ewigkeit zuständigen" Vatikan übergeben will. Doch um welche Wiedergutmachung geht es?
Nach seinem Kriegseinsatz auf dem Balkan arbeitete Mirkovic für den französischen Geheimdienst: "Ich begann in der Hölle Algerien als drittklassiger Aktenführer, in einer Welt von lächelnden Schlächtern und Mördern, die Kindern die Kehle durchschnitten". Doch bald schon ist Mirkovic der Diener vieler Herren: Er verrät seine Informanten, kooperiert mit der CIA.
Wie der Autor Énard, der viele Monate im Nahen Osten verbracht hat und heute als Arabischlehrer in Barcelona lebt, scheint auch sein Ich-Erzähler bereits mehrere Leben hinter sich zu haben. Im Rhythmus der Eisenbahn wird die Landschaft nicht nur zum Erzählgrund, sondern auch zum Interpunktionsersatz. Städte, Landstriche und Ortschaften erhalten die Funktion von Ausrufungszeichen, Gedankenstrichen oder Doppelpunkten: Énard beschwört die Massaker, welche die "Zone" des Mittelmeerraums seit Menschengedenken durchlebt hat. Von der Schlacht bei den Thermopylen über den Italienfeldzug Napoleons, den Pistolenschuss Gavrilo Princips, die Deportation der griechischen Juden, das Abschlachten der Palästinenser in den Lagern von Sabra und Schatila, das Aufschlitzen einer serbischen Großmutter mit ihrem Kruzifix - und niemals folgt dieser endlosen Analepse ein Punctum. So erleben wir den Helden als "Ungeheuer an Egoismus und Vereinsamung", einen Kriegsverbrecher, dessen persönliche Lebensgeschichte dem Sog dieses literarischen Weltgedächtnisses, das Énards Roman auch sein will, immer wieder entrissen wird - und als Binnenerzählung seine grausame Wirkung auf den Leser entfaltet.
Gezogen von den Pferden des Achill, treibt der Autor seine Geschichte dem "Weltende" entgegen: eine epische Raserei, der eine kriegerische Raserei vorangegangen ist, die wiederum ihre Vorläufer in den Rasereien der Menschheitsgeschichte hat. Énard besänftigt seinen Achill, indem er den Zug in seinem Zielbahnhof ankommen lässt, und er beendet seine Suada mit einem Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Aber mit was für einer Wirkung!
Anfang November wird in Frankreich der Prix Goncourt vergeben, Énard ist mit seinem neuen Buch im Finale. Man erinnere sich: Aus Jonathan Littells Goncourt-geehrten "Wohlgesinnten" ließ sich der Ästhetizismus des Bösen herausschmecken. Énard entlässt uns einfach in den Lauf der Geschichte, hinter die sich kein Punkt setzen lässt, was sie am deutlichsten von der Literatur unterscheidet.
Mathias Énard: "Zone". Roman.
Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Berlin Verlag, Berlin 2010. 589 S., geb., 28,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Mit gemischten Gefühlen schreibt Rezensentin Marie Schmidt über diesen Roman. Man muss offenbar mit harten Bandagen ausgestattet sein, um die Lektüre beenden zu können. In Mathias Enards Roman sitzt ein Mann mit einer geheimnisvollen Aktentasche im Zug und überlässt sich einem Bewusstseinsstrom, der von Ereignissen getragen wird, die er selbst erlebt hat, und von seinen Assoziationen. Immer neue Bilder der Gewalt des 20. Jahrhundert stapeln sich aufeinander: Algerienkrieg, Jugoslawienkrieg, Holocaust, Folter, Mord. Als Leser fühlt man sich mitunter, als höre man dem Schwadronieren eines Betrunkenen zu, so Schmidt, die das offenbar auch nur schwer ertragen hat. Meisterhaft findet sie dagegen die Fähigkeit Enards, die gravierende Frage wer hier die Opfer und wer die Täter sind, im Unentschiedenen zu belassen. Das ist ihr allemal lieber als ein Roman wie Littells "Die Wohlgesinnten", der sich mit der Täterperspektive geradezu brüstet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH