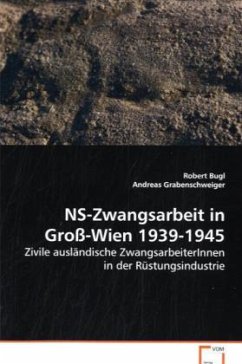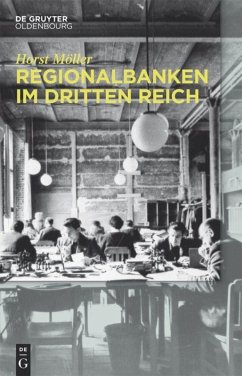Zulieferer für Hitlers Krieg
Der Continental-Konzern in der NS-Zeit
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
49,95 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Zulieferindustrie für Kraft- und Luftfahrzeuge war das eigentliche Rückgrat der nationalsozialistischen Rüstungs- und Kriegswirtschaft. Auf der Basis vielfach neu erschlossener Quellen aus dem Archiv wie verschiedenen Registraturbeständen von Continental wird die Entwicklung des Gummi- und Reifenunternehmens in der NS-Zeit erstmals umfassend untersucht. Ausgehend von der schleichenden Transformation der Unternehmenskultur und der Entwicklung Continentals zu einem NS-Musterbetrieb wird eingehend die Unternehmenspolitik im Kontext des nationalsozialistischen Vierjahresplans und die Radik...
Die Zulieferindustrie für Kraft- und Luftfahrzeuge war das eigentliche Rückgrat der nationalsozialistischen Rüstungs- und Kriegswirtschaft. Auf der Basis vielfach neu erschlossener Quellen aus dem Archiv wie verschiedenen Registraturbeständen von Continental wird die Entwicklung des Gummi- und Reifenunternehmens in der NS-Zeit erstmals umfassend untersucht. Ausgehend von der schleichenden Transformation der Unternehmenskultur und der Entwicklung Continentals zu einem NS-Musterbetrieb wird eingehend die Unternehmenspolitik im Kontext des nationalsozialistischen Vierjahresplans und die Radikalisierung der Produktionsprozesse mit Zwangsarbeit und Expansion in die besetzten Gebiete im Verlauf des Krieges untersucht. Es handelt sich dabei aber auch um eine vergleichende Geschichte, da unter anderem auch die später zum Continental-Konzern hinzugekommenen Unternehmen Phoenix sowie Teves und VDO, die hydraulische Präzisionssteuergeräte für das Heer und die Luftwaffe entwickelt haben, mituntersucht werden. Denn mit dem Kauf und der Übernahme eines Unternehmens wird auch dessen Geschichte mit allen Höhen und Tiefen miterworben, die dann gleichsam Teil einer neuen Konzerngeschichte werden. Obschon inzwischen zahlreiche Untersuchungen zu Unternehmen im Dritten Reich erschienen sind, bietet die vorliegende Studie eine Reihe neuer Erkenntnisse und Untersuchungsaspekte.