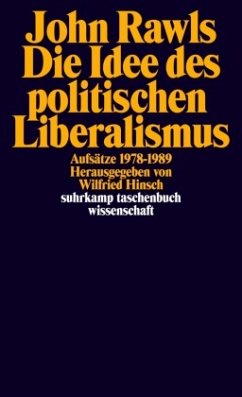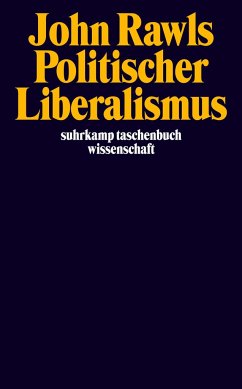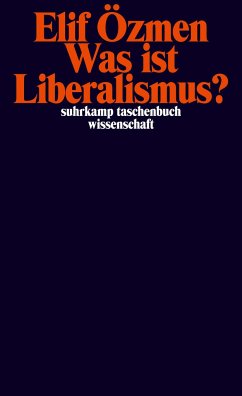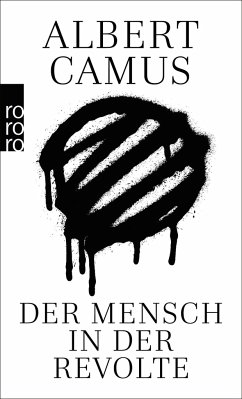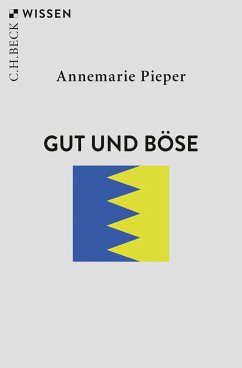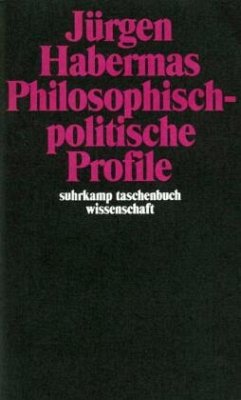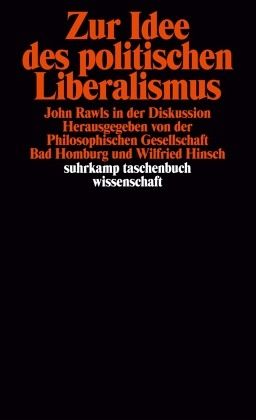
Zur Idee des politischen Liberalismus
John Rawls in der Diskussion
Herausgegeben: Hinsch, Wilfried; Philosophische Gesellschaft Bad Homburg;Übersetzung: Hinsch, Wilfried
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
23,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Band enthält zwölf Beiträge zur aktuellen Diskussion über den politischen Liberalismus. Er geht aus einer Arbeitstagung mit John Rawls hervor, deren Ziel es war, die philosophische und politische Tragfähigkeit einer nur auf den Bereich des Politischen beschränkten Theorie der Gerechtigkeit zu prüfen, wie sie Rawls in seinen jüngsten Aufsätzen vorgestellt hatte.Vom traditionellen Liberalismus unterscheidet sich John Rawls politischer Liberalismus durch seine philosophische Bescheidenheit. Der für moderne demokratische Gesellschaften charakteristische Pluralismus schließt es aus, ...
Der Band enthält zwölf Beiträge zur aktuellen Diskussion über den politischen Liberalismus. Er geht aus einer Arbeitstagung mit John Rawls hervor, deren Ziel es war, die philosophische und politische Tragfähigkeit einer nur auf den Bereich des Politischen beschränkten Theorie der Gerechtigkeit zu prüfen, wie sie Rawls in seinen jüngsten Aufsätzen vorgestellt hatte.
Vom traditionellen Liberalismus unterscheidet sich John Rawls politischer Liberalismus durch seine philosophische Bescheidenheit. Der für moderne demokratische Gesellschaften charakteristische Pluralismus schließt es aus, die obersten Grundsätze einer das menschliche Leben insgesamt umfassenden moralischen Lehre zu rechtfertigen, wie Kant und John Stuart Mill dies versucht hatten. Dieser Einwand gilt nach Rawls auch für Habermas Versuch einer diskursethischen Rekonstruktion der normativen Voraussetzungen pluralistischer Demokratie.
Vom traditionellen Liberalismus unterscheidet sich John Rawls politischer Liberalismus durch seine philosophische Bescheidenheit. Der für moderne demokratische Gesellschaften charakteristische Pluralismus schließt es aus, die obersten Grundsätze einer das menschliche Leben insgesamt umfassenden moralischen Lehre zu rechtfertigen, wie Kant und John Stuart Mill dies versucht hatten. Dieser Einwand gilt nach Rawls auch für Habermas Versuch einer diskursethischen Rekonstruktion der normativen Voraussetzungen pluralistischer Demokratie.