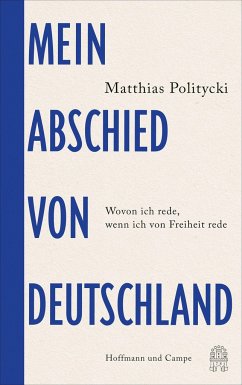Nicht lieferbar

Zur Sache!
Für eine neue Streitkultur in Politik und Gesellschaft
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Warum wir wieder lernen müssen, richtig zu streiten.Ohne Streit ist unsere Demokratie nicht überlebensfähig. Wir brauchen die Auseinandersetzung, um eine öffentliche Meinungsbildung zu ermöglichen und konstruktive Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Aber wir erleben heute, dass die inhaltliche Auseinandersetzung immer seltener wird und sich die Debatte in die sozialen Medien und die Talkshows verlagert hat. Dort gehen die Akteure Parteien mit ungeprüften Fakten und Behauptungen aufeinander los, bleiben Meinungen unversöhnlich nebeneinander stehen und werden keine Kompromisse mehr gesucht...
Warum wir wieder lernen müssen, richtig zu streiten.Ohne Streit ist unsere Demokratie nicht überlebensfähig. Wir brauchen die Auseinandersetzung, um eine öffentliche Meinungsbildung zu ermöglichen und konstruktive Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Aber wir erleben heute, dass die inhaltliche Auseinandersetzung immer seltener wird und sich die Debatte in die sozialen Medien und die Talkshows verlagert hat. Dort gehen die Akteure Parteien mit ungeprüften Fakten und Behauptungen aufeinander los, bleiben Meinungen unversöhnlich nebeneinander stehen und werden keine Kompromisse mehr gesucht. Es herrscht ein Kampf um Aufmerksamkeit, Selbstbestätigung und die Skandalisierung des Gegners. Andrea Römmele zeigt auf, warum es wichtig ist und wie es wieder möglich sein kann, miteinander zu streiten - ohne sich zu spalten.