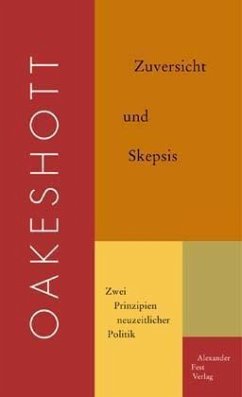Produktdetails
- Verlag: Fest
- Originaltitel: The Politics of Faith and The Politics of Scepticism
- 1. Auflage
- Seitenzahl: 320
- Deutsch
- Abmessung: 210mm
- Gewicht: 450g
- ISBN-13: 9783828601055
- ISBN-10: 3828601057
- Artikelnr.: 08133861
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Michael Oakeshotts ungläubige Politik / Von Patrick Bahners
Der Skeptiker hat laut Michael Oakeshott eine Begabung, die Henry James "the imagination of disaster" nennt, "die Einbildungskraft der Katastrophe", wie Christiana Goldmann übersetzt, also die Kraft, sich eine Katastrophe vorzustellen, ein Gespür für fernes Donnergrollen. Dieses Talent, durch Erfahrung geschult, findet im Horizont seiner Erfahrungswelt auch seine Grenze, und so hat man Oakeshott, den Bürger der glücklichen Insel, nicht des naiven Optimismus überführt, wenn man feststellt, daß er sich ein Fiasko wie die deutsche Rechtschreibreform nicht hat vorstellen können. In dem nachgelassenen Manuskript über zwei Grundtendenzen neuzeitlicher Politik, das Timothy Fuller herausgegeben hat, dient die Vereinfachung der englischen Schreibregeln als Beispiel einer skeptischen, die Textur der Überlieferung respektierenden Reform und wird mit der Reform des englischen Rechts verglichen, die sich auf die Harmonisierung von Verfahrensregeln beschränkte. Der Versuch, die Verfahren der Politik zu vereinfachen, entspräche nach Oakeshott dagegen dem Unternehmen, die Sprache selbst simpel zu machen durch Beschneidung des Wortschatzes und Verstümmelung der Syntax. Während zur Rechtssicherheit Übersichtlichkeit und Schnelligkeit von Prozeßverläufen gehören, hat die Umständlichkeit des politischen Prozesses ihren guten Sinn.
Wie das deutsche Experiment gezeigt hat, genügt eine Änderung der Schreibregeln, um den Wortschatz zu berauben und die Syntax zu malträtieren. Der Skeptiker darf sich auch bestätigt sehen, wenn seine schlimmsten Befürchtungen überboten werden. Man kann die deutsche Rechtschreibkatastrophe als klassisches Beispiel für die Verheerungen des von Oakeshott in einem Essay von 1962 geschilderten "Rationalismus in der Politik" betrachten. In der vermutlich 1952 abgeschlossenen Nachlaßschrift erscheint der Rationalismus unter dem Namen der "politics of faith". Die Politik mit dem Glauben ist der Glaube an die Politik, an die Planbarkeit der menschlichen Verhältnisse. Oakeshott, der an der London School of Economics jahrzehntelang ein legendäres Seminar abhielt, aber wenig publizierte, war der Eukalyptos des britischen Konservatismus: Obwohl er als Lehrstuhlnachfolger des Sozialisten Harold Laski eine öffentliche Person war, lag in seiner Lehrtätigkeit ein privater Zug, insofern er eher durch das gesprochene als durch das geschriebene Wort wirkte. Auch deshalb wird er häufig mit Leo Strauss verglichen. Oakeshotts Philosophie war allerdings das gerade Gegenteil der Lehre des "Wohlverborgenen" unter seinen griechischen Vorgängern, sofern man diese aus den wenigen erhaltenen Fragmenten erschließen kann. Daß der Wille erreicht, was er erstrebt, verhieß Oakeshott nicht. Er predigte freilich auch nicht die Meinung des Gelehrtenbuddhismus, äußere Erfolge seien bedeutungslos; ein Buch, das ihm 1936 den Ruf der Frivolität eintrug, trägt den Untertitel "How to pick a Derby winner". Wie er 1975 in seinen drei Abhandlungen "On Human Conduct" darlegte, wird die Freiheit des Handelns in seinem "adverbialen" Charakter sinnfällig: Der Mensch ist in der Lage, etwas in einer bestimmten Weise und in einem bestimmten Stil zu tun.
Daß der Wille verfehlt, was er begehrt, ist für eine Phantasie, der Adverbien einfallen, keine Katastrophe. Jeder Mensch gleicht in dieser Betrachtung einem Charakter von Henry James: "Dieser unaufgelöste und unauflösbare Charakter des menschlichen Verhaltens wird eingeschränkt (und nicht bloß verborgen), wenn Handlungen als Selbst-Inkraftsetzungen erkannt werden; das heißt, wenn sie verstanden werden im Sinne der Empfindungen, die ihre Ausführung begleiten. Es ist da wenigstens das Echo eines unvergänglichen Erfolges, wenn die Kühnheit des Handelnden und nicht der bald verschwindende Sieg, wenn seine Treue und Tapferkeit und nicht die flüchtige Niederlage die Gesichtspunkte sind; und selbst eine Handlung, die als pflichtgemäß angesehen wird, wird dadurch von der vergänglichen Willkür der sachlichen Unabgeschlossenheit befreit." Liest man diesen Satz, mag man verstehen, wieso kein deutscher Verlag sich an eine Übersetzung von "On Human Conduct" gewagt hat.
Die Sprache des englischen Originals, insbesondere die Konkretion, die den Abstrakta zuzuwachsen scheint, hat einen rauschhaften Effekt: Aus dem Kelche dieses Geisterreiches von Allgemeinbegriffen schäumt eine Unendlichkeit von Assoziationen. Als ironisch darf gelten, daß die Eigenheiten von Oakeshotts philosophischer Prosa in englischen Ohren deutsch klingen dürften; er hatte auch in Marburg und Tübingen studiert. Wie will man "selfenactment" übersetzen? Am nächsten liegt "Selbstverwirklichung", doch damit gehen Konnotationen verloren, die auf Theater und Recht verweisen. Das Verb "to enact" heißt sowohl "(eine Rolle) spielen" als auch "(ein Gesetz) machen": Der Mensch, der etwas auf seine Weise tut, ist also ein Selbstdarsteller, der sich zur Geltung bringt. Der Begriff hat jene präzise Zweideutigkeit, die man mit William Empsons "Seven Types of Ambiguity" in der Poesie und nicht in der Theorie sucht.
In der Nachlaßschrift, die in der sprachlichen Verdichtung nicht an "On Human Conduct" heranreicht, aber Glauben und Skepsis schon als gegensätzliche "Lektüren des menschlichen Verhaltens" deutet, erscheint die "ambiguity" noch eher als Problem für den politischen Philosophen denn als Ausdrucksmittel. Zwar wird die endlose Ausdeutbarkeit der politischen Rede als das Politische an ihr gedeutet. Aber der Philosoph betätigt sich, wenn schon nicht als Sprachreformer, so doch als Sprachkritiker, der die stillschweigende Verkehrung eingeführter Begriffe ins Gegenteil rügt, wenn etwa "freie" Sozialleistungen in einem System von Zwangsmitgliedschaften organisiert werden. Die an Orwell erinnernde Methode geht zurück auf den Idealismus des fulminanten Erstlings "Experience and its Modes" von 1933, den die Absicht einer Reinigung der Begriffe mit Wittgenstein verbindet. Oakeshott bestimmt dort Geschichte, Wissenschaft und Praxis als geschlossene und defizitäre "Modi" der "Erfahrung", Gestalten des Geistes, welche die Welt unter einem beschränkten Aspekt erfassen und deshalb von der wahren, grenzenlosen, widerspruchsfreien Erfahrung, die nichts anderes ist als die Philosophie, überwunden werden müssen.
Ähnlich legt Oakeshott im Nachlaßwerk dar, daß die reinen Formen der "politics of faith" und der "politics of scepticism" an ihren Selbstwidersprüchen scheitern. Die fanatische Politik übernimmt sich, feiert den vernünftigen Willen, um sich in dessen Gegenteil, die Naturkraft, zu verwandeln. Die skeptische Politik kommt sozusagen aus der Übung, ist im Notstand auf die Aushilfe des Glaubens angewiesen. Offenkundig steht hinter diesem Gedanken die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, als Churchill den Zweiflerclub seiner Kollegen vor der Niederlage rettete, indem er den Glauben der Nation an sich selbst mobilisierte. Die Politik als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, die Kopie der militärischen Kommandowirtschaft im Wohlfahrtsstaat, ist das Ziel der von den Idealtypen einer Gesamttheorie der Neuzeit eher konzentrierten als gebändigten Polemik. Im "Cambridge Journal" trat Oakeshott um 1950 der "Legende des Krieges" entgegen.
Sein Buch trifft heute auf deutsche Leser, die diese Legende zu einem Teil ihres eigenen Nationalmythos gemacht haben. Wer das neue Deutschland gar nicht genug dafür rühmen kann, daß es endlich am Ende des langen Wegs nach Westen angekommen ist, macht hier eine unheimliche Begegnung: mit einer alten und quicklebendigen westlichen Tradition des politischen Denkens, die universalen Menschenrechten mißtraut. Einen Autor, der seine Untersuchung mit der Feststellung eröffnet, die Politik biete zu allen Zeiten ein unerfreuliches Schauspiel, würde man hierzulande einen Unpolitischen schimpfen. Doch es gibt einen anti-republikanischen Begriff der Zivilgesellschaft, für den sich der Mensch nicht im Bürger erfüllt. Nicht nur an dieser Stelle geht einem auf, wieviel John Pocock, der sich 1968 an Oakeshotts Festschrift beteiligte, ihm verdankt. Mit dem Wesen des skeptischen "Regierungsstils ist es ebenso unvereinbar, einen moralischen Kreuzzug gegen ein eigenes Land zu führen wie gegen irgendwelche Landeskinder". Ein solcher Satz müßte die Mitglieder einer Regierung mit Abscheu erfüllen, die soeben den verspäteten Sieg über den äußeren Feind namens Milosevic gefeiert hat und nun den inneren Feind mit Konzerten "gegen rechts" erledigen will. Für Antifaschisten und für Antikommunisten ist das Buch ein Skandal. Von den Staatsverbrechen des zwanzigsten Jahrhunderts ist in dieser Theorie des gegenwärtigen Zeitalters mit keinem Wort die Rede, Stalins und Attlees Glaubensstaaten unterscheiden sich angeblich nur im "Grad" des rationalen Fanatismus. Soll man sich darüber wundern, daß Amerika keine Rolle spielt, oder soll man es souverän nennen, daß Oakeshott die Sprachregelungen des Kalten Krieges ignoriert? In Amerika findet man jedenfalls das Gegenbeispiel zu seiner nostalgischen Phantasie, das Unglück der modernen Welt sei, daß sie das mittelalterliche Verständnis von Politik als Rechtsprechung aufgegeben habe: Der Supreme Court beweist, daß es nicht zu einer skeptischen Selbstbeschränkung der Staatsmacht führen muß, wenn jede politische Frage als rechtliche behandelt wird.
Wegen der Asymmetrie von Glaube und Skepsis, die in der polemischen Absicht liegt, fehlt der Argumentation die Spannung; zu offenkundig ist, daß Oakeshotts dritter Weg, die Politik der Vermittlung, nur eine Maske der Skepsis ist. Vielleicht hat der Autor das Buch wegen dieses Konstruktionsmangels liegenlassen. Die Übersetzung von "faith" durch "Zuversicht" amputiert die theologische Dimension. Man kann sich gut in die Vertreterkonferenz des Alexander Fest Verlages hineinversetzen, in der gewiß argumentiert wurde, "Glaube und Skepsis" könne nur bei Herder laufen. Aber bei Oakeshott kommt alles auf die Obertöne an, die in den Vokabeln mitschwingen. Nur als Dokument einer historischen Erfahrung könnte Oakeshotts Buch philosophisch interessant werden. Doch statt die Anspielungen auf den englischen Sonderweg aufzuschlüsseln, die man in England verstehen mag, läßt der Verlag den Leser mit dem redundanten Nachwort des amerikanischen Herausgebers allein.
Der Bewunderer des Novalis dachte Philosophie und Politik als unendliches Gespräch: Die Tradition sah er als Gewebe von "intimations" - noch ein unübersetzbarer Begriff, dessen Inhalt mit "Andeutungen" nur angedeutet ist. Er mußte darauf vertrauen, daß seinen Landsleuten ihre Sprache wohlbekannt sei, durfte nicht nur annehmen, sie sei wohl bekannt. Er hat es wohl verdient, auch unter uns bekannt zu werden.
Michael Oakeshott: "Zuversicht und Skepsis". Zwei Prinzipien neuzeitlicher Politik. Nachwort von Timothy Fuller, Vorwort von Wilhelm Hennis. Aus dem Englischen von Christiana Goldmann. Alexander Fest Verlag, Berlin 2000. 270 S., geb., 58,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rüdiger Suchsland räumt zwar dem 1952 entstandenen und jetzt wieder aufgelegten Buch des 1990 verstorbenen britischen Autors wenig Relevanz für eine aktuelle politische Theorie ein. Doch findet er den Band "repräsentativ" für einen "politischen Konservativismus" und insofern immer noch lesenswert. Er lobt die Ausführungen, die Oakeshott zwischen den eher "polemisch" verwendeten Begriffen Zuversicht und Skepsis aufspannt - wobei er eindeutig zur Skepsis tendiert - als "intellektuell ausgefeilt" und empfiehlt den Nachlassband nachdrücklich als Lektüre für diejenigen konservativen Politiker, die bei der Verteidigung ihrer veränderungsfeindlichen Positionen nur allzu gern auf "Ausfluchtformeln" ausweichen. Denn richtig "interessant" werde das Buch dort, wo der Autor auch die eigene skeptische Haltung gründlich hinterfragt, so der Rezensent angetan.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH