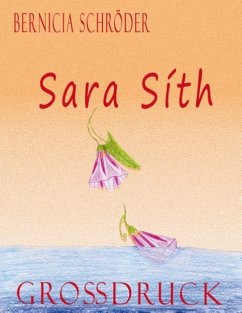Zwischen Wahrheit und Dichtung
Winston Churchill und Charlie Chaplin - zwei große Männer der Weltgeschichte, so unterschiedlich wie nur möglich und doch enge Freunde. Der eine schuf als weltberühmter Komiker das Meisterwerk 'Der große Diktator', der andere führte mit seinem Widerstandswillen eine ganze Nation durch den Krieg gegen Adolf Hitler.
Michael Köhlmeier hat mit dem Blick des großen, fantasievollen Erzählers erkannt, was in diesem unglaublichen Paar steckt: die Geschichte des 20. Jahrhunderts zwischen Kunst und Politik, zwischen Komik und Ernst.
Winston Churchill und Charlie Chaplin - zwei große Männer der Weltgeschichte, so unterschiedlich wie nur möglich und doch enge Freunde. Der eine schuf als weltberühmter Komiker das Meisterwerk 'Der große Diktator', der andere führte mit seinem Widerstandswillen eine ganze Nation durch den Krieg gegen Adolf Hitler.
Michael Köhlmeier hat mit dem Blick des großen, fantasievollen Erzählers erkannt, was in diesem unglaublichen Paar steckt: die Geschichte des 20. Jahrhunderts zwischen Kunst und Politik, zwischen Komik und Ernst.
Nicht weniger als die Geschichte des 20. Jahrhunderts zwischen Kunst und Politik, zwischen Komik und Ernst. prberghoff.de 20160120
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Ein paar stilistische Ausrutscher nimmt Klaus Nüchtern dem Autor nicht übel. Das liegt an Michael Köhlmeiers Talent, Fiktion und Fakten mit Verve und Intelligenz miteinander zu verbinden. In seinem neuen Buch nimmt sich Köhlmeier der Freundschaft zwischen Churchill und Chaplin an, ein Untenehmen nicht ganz ohne Fährnisse, wie Nüchtern feststellt, der ein paar Seiten braucht, um mit dem Buch warm zu werden. Was er dann jedoch liest, eine Geschichte, die so tut, als sei sie ausgiebig recherchiert, schließlich aber doch ein ausgefuchstes Fabulierspiegelspiel darstellt samt doppelten Böden, macht Nüchtern Spaß, auch wenn es dabei ja eigentlich um zwei Depressive geht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Die beiden Freunde hatten etwas gemein, von dem nur wenige wussten. Was es ist, erzählt Michael Köhlmeier in seinem Roman "Zwei Herren am Strand".
Erzählen, um zu überleben, auch wenn das Leben einen noch so sehr durchrüttelt, davon handeln letztlich alle Geschichten von Michael Köhlmeier, so sein großangelegtes Panorama "Abendland" über das schlimme zwanzigste Jahrhundert oder die Novelle "Idylle mit ertrinkendem Hund" über den Versuch, sich vor dem größten Schmerz überhaupt zu retten. Denn wer noch erzählen kann, ist noch immer da.
Dass der österreichische Schriftsteller jetzt ausgerechnet Charlie Chaplin und Winston Churchill zu Helden seines neuen Romans "Zwei Herren am Strand" gemacht hat, lässt sich deshalb auch nicht mit dem Genie dieser Ikonen des zwanzigsten Jahrhunderts erklären. Köhlmeier interessiert an den beiden Engländern etwas anderes: ihre ungewöhnliche Freundschaft. Denn so unterschiedlich sie auch waren - der eine entstammte höchstem britischem Adel, der andere ärmsten Verhältnissen -, so verband sie ein dunkles Geheimnis: Beide litten an Depressionen. Als Chaplin und Churchill auf einer Party zufällig ihre Wesensverwandtschaft erkannten, schlossen sie einen Pakt: Wenn der "schwarze Hund", wie der schwermütige Dichter Samuel Johnson die Krankheit nannte, einem auflauerte, würde der andere sofort zu Hilfe eilen. Und so trafen sich die beiden Männer in größeren Zeitabständen immer wieder, in Amerika, England oder Deutschland, gingen spazieren und redeten, "talk-walks" nannten sie ihre Art der Therapie.
Was in diesem Roman nacherzählt, was erfunden ist, das lässt sich wie so oft im Werk von Michael Köhlmeier nicht zweifelsfrei sagen. Dieser Autor lässt in seinen Büchern historische Fakten und Figuren immer wieder nahtlos in Fiktion übergehen. Der Ich-Erzähler, ein Clown, der berichtet, was ihm sein Vater über die beiden Helden erzählte, begibt sich dabei auf einen Grenzgang. Zwar sichtet er allerlei Dokumente, Schriften, Bücher und wertet viele Interviews und Gespräche zu Chaplin und Churchill aus, doch ist sein Material letztlich unzuverlässig, weil Schlüsselwerke wie etwa "Chaplins Tugend" eines Chaplin-Forschers längst vergriffen seien, wie der Erzähler gesteht. Der Bericht von Churchills angeblichem Privatsekretär William Knott, einem weiteren fiktiven Kronzeugen, beginnt sogar mit dem Bekenntnis: "Seit 35 Jahre lüge ich." Ausgangspunkt des Erzählens ist hier eben nicht die eine existierende Wirklichkeit, sondern der Erzähler, der versucht, diese Wirklichkeit zu beschreiben - und oft genug daran scheitert.
Weil nun bekanntlich Churchill und Chaplin weder politisch noch künstlerisch je einer Meinung waren - für den einen war Gandhi ein großer Politiker, für den anderen bloß ein nackter Fakir -, konnten sie sich bei ihren Gesprächen auch gar nicht lange mit Smalltalk aufhalten; sie mussten gleich zur Sache kommen. Stundenlang konnten sie sich dann über Motive und Techniken des Selbstmords austauschen und erzählten sich die letzten Stunden im Leben berühmter Selbstmörder wie Seneca, Hannibal oder Jack London. "Nüchtern bis zur Erleuchtung", lässt Köhlmeier seinen Erzähler resümieren, wollten sie der Schwermut entgegentreten.
Dass ausgerechnet ein Ausnahmerhetoriker wie Churchill, der zu Beginn der dreißiger Jahre zwar gerade ohne politisches Amt, dafür aber Englands bestbezahlter Kolumnist war, nur noch stammeln und stottern konnte, wenn die Depression ihn übermannte, ist schicksalhaft. Meist nahm Churchill dann seine Staffelei und malte Landschaften. Der Kriegsheld aber hatte noch eine weitere, rührend-grotesk anmutende Waffe gegen den inneren Feind. Das Schwergewicht Churchill legte sich hierzu bäuchlings auf einen Bogen Papier am Boden, drehte sich im Uhrzeigersinn und schrieb sich selbst einen Brief.
Bei Chaplin setzten die Angstzustände hingegen immer dann ein, wenn er gerade einen Film abgedreht hatte; dann packten ihn Selbstzweifel, und er konnte oft tagelang nicht sprechen. Nicht zuletzt, dass Chaplin ausgerechnet an jener Figur des Tramps litt, die er selbst erschaffen und die ihn weltberühmt gemacht hatte, zeigt die irrationale Grausamkeit der Krankheit. Auf die Frage am Ende seines Lebens, ob es ihn nicht getröstet habe, dass er nicht nur der beliebteste Schauspieler, sondern sogar der beliebteste Mensch der Welt gewesen sei, rief Chaplin entgeistert aus: "Ich? Meinen Sie? Meinen Sie tatsächlich? Was meinen Sie damit? Ich war niemand! Alles war der Tramp! Jeder, der mich auf der Straße erkannte, der mir bis vor kurzem zugejubelt hätte, jeder sah in mir den Tramp. Geliebt wurde nur der Tramp. Als wäre er nicht ich." Dass in Wahrheit nicht er den Tramp, sondern der Tramp ihn beherrschte, davon war Chaplin überzeugt.
Der in fünf Kapitel unterteilte Roman springt dramaturgisch geschickt in der Zeit vor und zurück. Er speist sich aus Köhlmeiers großen Kenntnissen der Kultur- und Zeitgeschichte, die er mit biographischen Momentaufnahmen aus dem Leben des Politikers und des Leinwandkünstlers spannend verknüpft, so dass man dem Autor Abschweifungen wie etwa über Henri Bergsons Begriff des Komischen verzeiht. Adornos "Methode des Clowns" dagegen ist so treffend skizziert, als hätte der Philosoph den Essay tatsächlich verfasst.
Die Schilderungen von Churchills schlimmen Jahren als Internatszögling, den die Eltern abgeschoben haben, sind dabei mindestens so erschütternd zu lesen wie die über Chaplins Londoner Kindheit in größter Armut, die seine Mutter, eine verarmte Varieté-Soubrette, nicht abzuschütteln vermochte. Dass diese beiden Großmeister allerdings auch grandiose Egomanen waren, auch das macht Köhlmeier in einer Begegnung während eines Dinners deutlich, als sie einmal nicht von Depression gezeichnet sind.
So unterschiedlich Churchill und Chaplin auch waren, hatten sie, und darauf zielt dieser Roman natürlich hin, neben ihrem inneren Feind bald einen noch viel größeren Gegner, den sie beide, jeder auf seine Weise, mit aller Macht bekämpfen sollten: Adolf Hitler.
SANDRA KEGEL
Michael Köhlmeier:
"Zwei Herren am Strand". Roman.
Carl Hanser Verlag, München 2014. 256 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

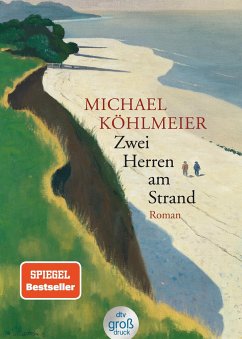
![Cat's Rest [Großdruck] Cat's Rest [Großdruck]](https://bilder.buecher.de/produkte/55/55073/55073893m.jpg)