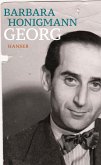Was, wenn die Juden die Erde verlassen und zum Mond fliegen? Eine unglaubliche Allegorie auf das Fremdsein vieler Juden. Eingebettet in eine Liebesgeschichte im Berlin der 1930er-Jahre verhandelt der später von den Nazis ermordete Rabbi Martin Salomonski die Grundprobleme des Judentums, umgeben von aufkeimendemNationalismus und Nationalsozialismus. Salomonski ist eine Wiederentdeckung, wert gelesen zu werden - in der Folge expressionistischer Autoren der 20er-Jahre.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Philipp Theisohn stellt sich der Widerständigkeit von Martin Salominskis "Zukunftsroman" aus dem Jahr 1934. Zunächst stellt er fest, dass die im Nachwort erörterten literarischen Qualitäten des Textes, Tempo, "szenisches Pathos" etc, wohl am ehesten seiner Veröffentlichung als Fortsetzungsroman geschuldet sind. Reizvoll dagegen erscheint Theisohn der Text vor allem wegen seiner Zusammenführung disparater Themen: Technologie, Gedächtnis, Verantwortung der Wissenschaft, liberales Judentum, Extraterrestik. Zwar etwas viel, gibt Theisohn zu, aber eben auch Ausweis der "widerständigen" Vorstellungskraft des Autors und seines Wunsches nach einer "extramondänen" Zukunft.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Jüdischer Exodus ins Außerirdische: Martin Salomonskis Mondreise-Roman "Zwei im andern Land" von 1934 erscheint neu.
Um ehrlich zu beginnen: Die Merkwürdigkeit von Martin Salomonskis "Zwei im andern Land", bei seinem Erscheinen 1934 als "Zukunftsroman über die Lösung der Judenfrage" beworben und nun, 87 Jahre später, im Berliner Vergangenheitsverlag neu aufgelegt, kann und darf auch nicht in der literarischen Qualität dieses Textes gesucht werden. Es handelt sich hier um einen zunächst in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" erschienenen Fortsetzungsroman, dessen Veröffentlichungspraxis spürbaren Einfluss auf das Erzählverfahren genommen hat. Rasche Schauplatzwechsel, eher brachial verwobene Handlungsfäden sowie eine starke Konzentration auf szenisches Pathos, Aphorismen und Sentenzen charakterisieren die Erzählung - und nichts davon, hier muss man leider auch dem Nachwort des Herausgebers Alexander Fromm widersprechen, hat mit avantgardistischer Prosa zu tun. Dennoch: Das alles trägt nichts ab, denn der Reiz von "Zwei im andern Land" ist gerade in der mitunter schroffen Engführung von Themenkomplexen zu suchen, deren Zusammenhang sich nur untergründig erschließt.
An der Oberfläche stehen die Dinge so: Im Jahr 1953 erfindet der Werbetexter Victor Arago in einer Küstenstadt namens "Maimi" eine Apparatur, mit deren Hilfe dem menschlichen Gedächtnis bereits unzugängliche Szenen wieder aus den "Vorratskammern des Gehirns" hervorgeholt und auf eine Leinwand projiziert werden können. Bevor er dieses "Tonfilm-Patent" jedoch an ein Konsortium verkaufen kann, wird er von sechs Frauen entführt - unter ihnen Mica Cohn, elternlos in einem Kloster aufgewachsen, in die sich der Entführte sogleich verliebt. Im Moment des wechselseitigen Bekennens wird das Paar während einer Mondfinsternis durchs All auf den Erdtrabanten entrückt, dessen Bevölkerung die Astronauten feierlich empfängt. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei den Möndlern um "Israels Kinder" und bei ihrem Oberhaupt um Micas verschollenen Vater, der sogleich die Vermählung von Tochter und Schwiegersohn - einer aschkenasischen Jüdin und eines Marranen - einleitet. Der Rückweg zur Erde führt die Vermählten nach Berlin, Mica wird schwanger, Victor unternimmt eine Reise nach Maimi und "entgleitet dort leiblich" mit Micas bester Freundin, kehrt aber reumütig rechtzeitig zur Geburt nach Deutschland zurück. Die Liebesgemeinschaft verwandelt sich darüber in eine Zweckgemeinschaft: Gemeinsam entschließen sich die beiden, "Israel zu sammeln" und über die Zwischenstation Nordafrika alle Juden der Erde in einer Massenprozession zum Mond zu führen.
Natürlich wird hier viel zu viel gewollt - und gerade deswegen erschließt sich dieser Roman am ehesten von jenem Punkt aus, an dem er seine eigene Überforderung offen zu erkennen gibt. So bleibt unter dem steten Wechsel des Leitmotivs zunächst einmal der Reiz des technologischen Novums - des Erinnerungsprojektors - auf der Strecke. Um ihn aufgebaut werden sollte ganz offensichtlich eine Reflexion wissenschaftlicher Verantwortung: Was auf den ersten Blick ein atemraubendes Instrument menschlicher Introspektion sein könnte, bleibt in der Demonstration vor Micas Berliner Verwandtschaft ein Spielzeug zur sentimentalischen Vorführung historischer Momente und privater Schicksalsszenen (bis hinab zur Abiturprüfung). Warum die Gerätschaft in den falschen, sprich: in kapitalistischen Händen "äußerst gefährlich und für unsere Nerven untragbar" sein könnte, ja, warum sie dringend dem deutschen Staat überstellt werden müsse, da nur so "das Gewissen und die Zukunft der Welt geschärft und geborgen" seien: Das bleibt unplausibel. Ein Leichtes wäre es gewesen, die Funktion eines solchen Apparats im Polizeiwesen, in der Überwachung und in der Folter als äußerste Folge zu imaginieren, aber diese Spur gibt es nicht. Stattdessen kommt es irgendwann - en passant - zum Geständnis, dass die Patentfrage "ohnedies aufs tote Gleis gekommen" sei.
Der offenkundige Unwille, die Dinge bis zum Ende zu denken und von diesem Ende her auch zu handeln, ist nun aber geradewegs das Paradigma, das in diesem Text die technologische Erzählung mit dem jüdischen Familienroman verklammert. Dieser dokumentiert in selten gesehener Deutlichkeit das Dilemma des liberalen Judentums in der Prägung Abraham Geigers und Leo Baecks: Einerseits konstatiert der Roman unumwunden, dass "die Halbheit, sich rassisch behaupten zu wollen und doch als vollgültiges Element in verschiedenen Zeitepochen, inmitten einer Unzahl von Nationen dazustehen, mehr als ein Fehler" ist. Andererseits schreckt er vor der Konsequenz dieser Diagnose, die den Grundstein der politischen Theologie des Zionismus bildet, dann doch zurück. Aufmerksam verfolgt man die Aufbauten in Palästina, macht deren Erfolg aber ganz von einer Aufhebung des "Gegensatzes zwischen der arabischen Bevölkerung und den Juden" abhängig, ohne die von "einer Zuflucht im Lande der Väter die Rede nicht sein konnte".
An dieser Stelle kommt nun aber die dritte, die extraterrestrische Erzählung ins Spiel. In ihrer Anlage und Ausführung weitaus mehr den Weltraumfahrten des siebzehnten Jahrhunderts von Kepler bis Cyrano de Bergerac verbunden als der zeitgenössischen Science-Fiction, ist das "andere Land" des Mondes in diesem Text kein Gestaltungsraum. Nichts verbindet diesen Mond mit der Konkretion der politischen Lage. Er ist keine Polis. Das, was eine in Nordafrika mit Hilfe der alten Kolonialmächte errichtete Kolonie leisten könnte - nämlich die Errichtung eines jüdischen Staatswesens -, wird mit dem seltsam untermotivierten Weiterzug der Juden zum Mond verabschiedet. An die Stelle des Staats tritt etwas anderes: nämlich der Wunsch, vermisst zu werden. Dass die großen Nationen der Erde, ihre politischen Führer und der Papst, die Juden bitten, den Planeten nicht zu verlassen - das ist die Volte, die dieser Text sucht, eine Volte, die ihn mit Hugo Bettauers immer noch lesenswertem Roman "Die Stadt ohne Juden" (1922) verbindet. Die unauflösliche Verbundenheit des jüdischen Volkes mit dem Schicksal seiner Drangsalierer wird in jenem Moment zutage treten, in dem das Judentum aus den Städten, aus dieser Welt verschwindet. Es ist ein virtuelles Verschwinden, denn sein Zweck liegt im Bleiben, im Aufspüren von Empathie.
Gewiss ist dieses Hoffen auf Empathie ein Fehler gewesen, und man wird dem Rezensenten der "Jüdischen Rundschau" beipflichten müssen, der "den Augenblick, da alle Kräfte der Judenheit auf die konkreten Aufgaben des Palästina-Aufbaus konzentriert werden müssen, für eine romantische Lösung nicht geeignet" hielt. Gleichwohl: "Zwei im andern Land" ist - gerade in seiner Ungefügtheit - das aufrechte Zeugnis einer widerständigen Phantasie, die dem festen Vorsatz folgte, allen äußeren Anfechtungen das Bild einer mondänen wie extramondänen, in jedem Fall: einer bürgerlichen Zukunft entgegenzustellen. Das Jahr 1953, in dem Victor Arago sein "Tonfilm-Patent" zu Markte trägt, hat Martin Salomonski, der im Ersten Weltkrieg als Feldrabbiner diente und bis 1940 als Rabbiner an der Berliner Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße waltete, nicht mehr erlebt. Am 16. Oktober 1944 wurde er in Auschwitz ermordet.
PHILIPP THEISOHN
Martin Salomonski: "Zwei im andern Land". Roman.
Vergangenheitsverlag, Berlin 2021. 228 S., br., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main