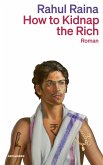"Vielschichtiger noch und erbarmungsloser als sein Debüt." -- Fiona Ehlers im 'Kulturspiegel'
Mit Witz und Furor, Mitgefühl und Humor, Mut und Leidenschaft erzählt Adiga Geschichten, in denen die unbarmherzigen Gegensätze und der unbeugsame Überlebenswille im heutigen Indien plastisch werden. Da ist der zwölfjährige Ziauddin, der in einem Teehaus in der Nähe des Bahnhofs aushilft und, weil er einem hellhäutigen Fremden vertraut, einen großen Fehler macht. Da ist ein privilegierter Schuljunge, der aus Protest gegen das Kastenwesen an seiner Schule Sprengstoff zündet. Und da ist George D'Souza, der Moskitomann, der sich bei der reizenden, jungen Miss Gomes zum Gärtner und dann zum Chauffeur hocharbeitet und alles verliert, als er die strengen Grenzen zu überschreiten versucht.
Mit Witz und Furor, Mitgefühl und Humor, Mut und Leidenschaft erzählt Adiga Geschichten, in denen die unbarmherzigen Gegensätze und der unbeugsame Überlebenswille im heutigen Indien plastisch werden. Da ist der zwölfjährige Ziauddin, der in einem Teehaus in der Nähe des Bahnhofs aushilft und, weil er einem hellhäutigen Fremden vertraut, einen großen Fehler macht. Da ist ein privilegierter Schuljunge, der aus Protest gegen das Kastenwesen an seiner Schule Sprengstoff zündet. Und da ist George D'Souza, der Moskitomann, der sich bei der reizenden, jungen Miss Gomes zum Gärtner und dann zum Chauffeur hocharbeitet und alles verliert, als er die strengen Grenzen zu überschreiten versucht.

Der indische Booker-Prize-Träger Aravind Adiga erzählt in "Zwischen den Attentaten" Geschichten aus einer Stadt der Gegensätze.
Da ist das Ding, mag er sich insgeheim denken. Es gibt ein Autorenfoto, das zeigt einen lächelnden Aravind Adiga, der stolz wie ein Pokalsieger den Man Booker Prize in Händen hält, den er im vorigen Jahr für seinen ersten Roman und internationalen Bestseller "Der weiße Tiger" erhielt. Doch für den 1974 in Madras geborenen Schriftsteller und Journalisten mag diese Auszeichnung womöglich auch eine schwere Hypothek bedeuten, wird doch alles Folgende an dem frühen Erfolg gemessen werden, der sich in sieben nächtlichen Briefen ausmalte, wie es in der indischen Gesellschaft unter dem Druck des Kastensystems und der nahezu unverrückbar festgezurrten Unterteilung in Arm und Reich mählich zu brodeln beginnt. Auch im beinah zeitgleich entstandenen "Zwischen den Attentaten" ist eine dräuende Gewalt unterschwellig zu spüren.
Die Sammlung von Vignetten, gegliedert in sieben Tage, führt in die fiktive Stadt Kittur, die an Indiens Südwestküste zwischen Goa und Calicut liegt. Sie hat knapp zweihunderttausend Einwohner mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit, eine unvollendete Kathedrale, einen Tempel eigens für die unterkastigen "Hoykas", ein Kino von zweifelhaftem Ruf, ein vitales Geschäftsviertel und eine renommierte Knabenschule; ein relativ kleiner Schmelztiegel also, der dennoch das Potential für große Konflikte, für politische, religiöse und private Spannungen birgt - selbst unter konkurrierenden Busunternehmen.
Sie entladen sich in einer Zeit der Unruhe, in den achtziger Jahren, zwischen den tödlichen Anschlägen auf Indira und Rajiv Gandhi. Dies ist aus den nüchternen, anschaulichen Einträgen eines Reiseführers zu erfahren, die den einzelnen Erzählungen vorangestellt werden, welche anschließend ins blühende und vergehende Leben führen. Denn Adigas Protagonisten, die ein weites Spektrum von gesellschaftlichen Schichten repräsentieren, stehen nahezu alle im Begriff, etwas Neues anzufangen oder etwas Altes hinter sich zu lassen; sie werden verprügelt, müssen sich mit der grassierenden Korruption herumschlagen oder schmerzlich erkennen, dass die traditionellen Hierarchien doch tiefer verwurzelt sind, als es ihnen ihr am Fortschritt orientierter Verstand weismacht.
Murali etwa, der sein ganzes Leben der Literatur und der Marxistisch-Maoistischen Kommunistischen Partei gewidmet hat, dessen Träume, der indische Maupassant zu werden und zugleich das Elend der Arbeiterklasse zu lindern, indes nicht in Erfüllung gingen, verliebt sich während einer nicht ganz uneigennützigen Hilfsaktion in eine sehr viel jüngere Frau. Sein Werben wird allerdings zurückgewiesen, was sein Selbst- wie sein Weltbild gehörig ins Wanken bringt. Er muss feststellen, dass ihn seine Einsicht in die materialistische Dialektik in Liebesdingen nicht weiterbringt. Plötzlich hat sich die zuvor propagierte Solidarität der Proletarier für ihn erledigt, und er erinnert sich an die Privilegien, die ihm als Brahmanen und Universitätsabsolventen zustehen sollten. Sein politisches Engagement begreift er als Irrtum; die Macht der Intrige jedoch, der er so lange widerstehen konnte, stellt er in den Dienst seines aufkeimenden Bedürfnisses nach persönlicher Rache; er genießt es sogar, die ehemals Bedürftigen nun in seiner Gewalt zu haben.
Derart desillusionierend gestalten sich die meisten Schilderungen Adigas, der gleichwohl mit einem exzellenten Blick für das Detail noch dort Augenblicke der Schönheit entdeckt, wo es am schmutzigsten und verkommensten zugeht. Dabei bleibt seine Prosa weitgehend frei von exotistischem Dekor, Sentimentalitäten oder allzu simplen Kontrastierungen in der Figurenzeichnung. Geschickt, allerdings ohne den Spannungsbogen eines Romans aufzubauen, fügt Adiga, der sich für sein vielschichtiges Stadtporträt von Autoren wie Balzac und Maupassant inspirieren ließ, die einzelnen Teile zu einem Ganzen. Er verbindet sie zuweilen durch personelle Überschneidungen, die zwar nie offensichtlich oder aufdringlich vermittelt werden, aber auch nicht für einen straffen Zusammenhalt sorgen. Weitaus weniger naheliegend, dafür stabiler ist hingegen das feinmaschige Geflecht von Motiven und Themen, das er knüpft: die Klänge der Stadt, die sich durch alle Bezirke ziehen; die Standesunterschiede, die einmal vergessen scheinen, um später umso deutlichere Grenzen zu ziehen; oder die skrupellose Instrumentalisierung und Zwangslage der Armut, wenn etwa der bei seinen Arbeitgebern stets in Ungnade fallende Muslim Ziauddin von einem wohlhabenden Paschtunen durch eine vermeintlich harmlose Tätigkeit in ein terroristisches Komplott verstrickt werden soll.
Adiga verfällt aber nicht in einen kulturpessimistischen Tenor; in seinem Kittur, wo es geduldet wird, dass Raubdrucke von "Mein Kampf" verkauft werden, nicht aber Exemplare von Rushdies "Die satanischen Verse", wo Stickerinnen so lange ausgebeutet werden, bis sie aufgrund ihrer kleinteiligen Arbeit erblinden, wo sich ständig Menschen zu Taten gezwungen sehen, die ihnen einen Vorteil verschaffen, für den andere auf der Strecke bleiben, in diesem augenscheinlich grässlichen Moloch gibt es trotzdem plötzlich aufscheinende Momente der Güte, der Menschlichkeit und der Würde. Für das beharrliche Insistieren auf Humanität, ohne dabei einen predigenden oder anprangernden Ton anzuschlagen, gebührt Adiga große Anerkennung.
ALEXANDER MÜLLER
Aravind Adiga: "Zwischen den Attentaten". Geschichten aus einer Stadt. Aus dem Englischen von Klaus Modick. Verlag C. H. Beck, München 2009. 376 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

„Zwischen den Attentaten” – Der neue Roman des indischen Booker-Preisträgers Aravind Adiga
„Den Reichen gehört die ganze Welt”, sagt eine Figur im Roman „Zwischen den Attentaten” von Aravind Adiga. Adiga erzählt darin fast nur von den Armen. Es ist, als wolle er ihnen, wenn schon nicht Gerechtigkeit, dann wenigstens Aufmerksamkeit widerfahren lassen, und vielleicht hat er auch deshalb keinen Molochroman geschrieben, der die Stadt als Helden mit steinernem Herz inszeniert, sondern einen Roman über eine mittelgroße, fiktive Stadt namens Kittur, die für viele indische Städte steht und bloß den Hintergrund abgibt für den Alltag der Massen. Im Vordergrund stehen die hungrigen Menschen auf hitzeflirrenden Straßen, über die Staub weht und die Verlockung, dem Verkäufer an der Ecke ein Brot zu stehlen.
Es sind viele Menschen, von denen der 1974 in Madras geborene und für seinen Roman „Der weiße Tiger” mit dem Man Booker Prize ausgezeichnete Adiga erzählt. Ein junger Mann aus der niederen Kaste der Hoykas steigt unter dem Schutz eines Zuhälters zum Oberschaffner in einem Bus auf, wird aber von dem Mann im Stich gelassen, als er sich bei einem Unfall eine Kopfverletzung zuzieht. George D’Souza, der „Moskitomann”, wird von einer reichen, von ihrem Mann verlassenen Frau angestellt und für immer mehr Dienste herangezogen. D’Souza bildet sich ein, die Frau liebe ihn, doch als er ihr einen Schritt zu nahe kommt, kündigt sie ihm. Sie war bloß eine Katze, die sich eine Maus ins Haus geholt hat.
Je mehr solcher Episoden man liest, desto deutlicher erkennt man den soziologischen Blick des ehemaligen Reporters der Financial Times, der verschiedene Bereiche der Gesellschaft erfassen will und sie immer von unten betrachtet. Klassengrenzen, zeigt Adiga, lassen sich in Indien nicht überspringen, nutzen aber auch nicht unbedingt den höheren Kasten. Murali, ein in die Jahre gekommener Mitarbeiter der kommunistischen Partei, hilft auf dem Land einer jungen Frau, das Formular für den Bezug von Witwenrente auszufüllen, verliebt sich in sie und rechnet sich als geborener Bramahne Chancen bei ihr aus. Doch sie will ihn nicht. Aus Verzweiflung gibt der 55jährige alle Glaubenssätze auf, hilft einem Geldverleiher, die Frau auszunehmen und wird wie viele Leute in Adigas Geschichten zu einem Geradlinigen, der sich brechen ließ.
Wer in Kittur Gerechtigkeit und Wahrheit will, droht sich an anerzogenem Kleinmut, Kastendenken und religiöser Verblendung die Zähne auszubeißen, an Korruption und Kriminalität, für die Armut die Menschen anfällig macht. Aber nicht jeder in diesem Roman gibt die letzten menschlichen Standards auf, wie der Fabrikbesitzer, der es gewohnt ist, Beamte zu bestechen, und doch so viel Anstand hat, seine erblindenden Näherinnen an einem Arbeitstag auf eigene Kosten nach Hause zu schicken.
Adiga schreibt direkt, dialogreich, nimmt sich Zeit, einen Blick auf die Vergangenheit seiner Figuren zu werfen, und Klaus Modicks Übersetzung lässt einen fast vergessen, dass der Roman ursprünglich auf Englisch verfasst wurde. Für short stories sind die meisten Geschichten, aus denen sich der Roman zusammensetzt, zu wenig prägnant, dafür entsteht nach und nach ein Mosaik aufschlussreicher, miteinander verzahnter Episoden, die die Stadt als großen Handlungszusammenhang zeigen, Politisches und Privates ineinanderschlingen und den begrenzten Spielraum der Bewohner ausmessen, die Opfer sind und dadurch oft zu Tätern werden, aber eben nicht nur dadurch.
Adiga erzählt mit Witz und Wärme, Heldendenkmäler gibt es ebensowenig wie reine Schurkengestalten, und wenn es ein einzelnes verbindendes Element gibt zwischen den Episoden seines Romans, dann ist es der immer wieder ausgerufene Fluch „Sohn einer Kahlgeschorenen!”, der sich auf den Brauch bezieht, Witwen kahl zu scheren zum Zeichen, dass sie nicht mehr heiraten dürfen. Uneheliche Kinder sind auf die eine oder andere Weise alle Figuren in Adigas Roman, in die Welt geworfen, aber unter ungünstigen Bedingungen am Leben.
Erstaunlich, welcher Spagat Adiga gelingt: Detailreich schildert er, welche Wünsche und äußeren Zwänge Keshava, Chenayya, Ziauddin und andere Figuren beherrschen, und macht zugleich sichtbar, wie durch ein weit verzweigtes Netz von Abhängigkeiten etwas so scheinbar fixsternhaft Enthobenes wie die Wahrheit in die Straße herabgezogen wird und hinter Geschäftemacherei, Gerüchten und der Zeitung verschwindet.
Der unter seinem Chef buckelnde Redakteur Gururaj bei Kitturs „einziger und bester Zeitung” ist einem Justizskandal auf der Spur und hört sich von einem Mann der Straße einen Augenzeugenbericht an, nach dem der reichste Mann der Stadt, Mr Engineer, einen Mann überfahren und einen Mitarbeiter dafür bezahlt haben soll, vor Gericht auszusagen, er habe am Steuer gesessen.
Doch Gururajs Chef lässt ihn die Geschichte nicht schreiben – das Blatt ist finanziell abhängig von Mr Engineer. Aber stimmt die Geschichte überhaupt? Die Nöte, die den Obdachlosen dazu getrieben haben könnten, sie zu erfinden, bleiben namenlos, aber dass es sie gibt, ist nur allzu gut möglich.
Vielleicht steht der Kriminelle, den alle Xerox nennen, am besten für Adigas Figuren. Der Raubkopierer hat sich, nachdem ihm Polizisten im Gefängnis die Beine gebrochen haben, in den Kopf setzt, nun erst recht Rushdies zensiertes Buch „Die satanischen Verse” zu kopieren. Aus gut gemeinten Taten entsteht Leid, aus Verbrechen Gutes, und jeder ist ein Engel mit Hörnern in Kittur, wo sich außer den Kasten vieles vermischt. KAI WIEGANDT
ARAVIND ADIGA: Zwischen den Attentaten. Roman. Aus dem Englischen von Klaus Modick. C. H. Beck Verlag, München 2009. 376 Seiten, 19,90 Euro.
Aravind Adiga in Mumbai Foto: India Today Group/Getty Images
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Mit Lob versieht Rezensentin Shirin Sojitrawalla dieses zweite Buch des Booker-Prize-Trägers von 2008, Aravind Adiga, wenngleich es aus ihrer Sicht "behäbiger, weniger komisch und weniger rasant" ist als der preisgekrönte Erstling. Doch auch diesmal scheue sich Adiga nicht, Indiens "brutale Wirklichkeit" und die Ungerechtigkeit seines Gesellschaftssystems in den Blick zu nehmen. Aber auch die "sagenhafte Schönheit" des Landes, sein "fabelhafter Schmutz" sei Gegenstand der Momentaufnahmen und Shortcuts aus einer fiktiven indischen Stadt in diesem Buch. Besondere Freunde hat die Rezensentin an den Figuren, die sich mit dem Elend nicht abfinden wollen. Es gebe immer wieder wunderschöne Geschichten, deren schönste sich für Sojitrawalla wie die "tropische Variante" von Tschechows "Kirschgarten" liest.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH