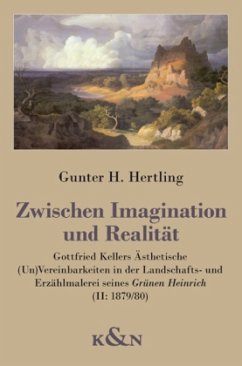Unter seinen Zeitgenossen C. F. Meyer (1825-1898), Theodor Storm (1817-1888) und Theodor Fontane (1819-1898) zählt Gottfried Keller (1819-1890) zu den vier bedeutendsten poetischen Realisten des 19. Jahrhunderts. Wie bekannt, zeichnen sich ihre Lyrik und Erzählkunst darin aus, dass sie das Phantastische, das Märchen- und imaginär Traumhafte in der Nachahmung der empirischen Wirklichkeit vereinbaren, und zwar so, dass diese zwei grundsätzlich unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen nahtlos zusammen fließen und sogar in einander aufgehen. Die vorliegende textkritische Untersuchung zu Kellers psychologisch dichterischem und großenteils autobiographischem Entwicklungsroman Der Grüne Heinrich in der zweiten Fasssung von 1879/80 weist Kellers frühe Zweifel, Bedrängnisse und Verzweiflungen als Landschaftsmaler nach, eine wirklichkeitsgetreue Realistik mit dem Imaginären zu vereinbaren. Heinrich Lee, der Protagonist und junge Künstler (Landschaftsmaler), wird sich im Verlaufe seiner in- und ausländischen Bildungsstadien der schwierigen (Un)Vereinbarkeit des Imaginären mit der empirischen Wirklichkeit bis zur Verzweiflung bewusst. Heinrichs Weg zeigt aber auch eindeutig Kellers schrittweises Gelingen, diese scheinbar auf Unversöhnbarkeit angelegten ästhetischen Widersprüche in seiner Landschaftsmalerei und vor allem in seiner Erzählkunst stilvoll mit einander zu verflechten.
Hertlings kritische Werkanalyse zeigt nicht nur Heinrich Lees frühe Realisierung der ästhetischen Diskrepanzen zwischen schöpferischer Phantasie und Imagination einerseits, entgegen einer scheinbar unbeugsamen Realität andererseits, sondern auch die Möglichkeit einer Vereinbarung beider Seinsebenen im Bereich der Landschafts- und Erzählmalereien. Es ist der poetische Realist, der sich letztlich das "Recht" aneignen kann, "auch im Zeitalter des Fracks und der Eisenbahnen, an das Parabelhafte, das Fabelmässsige ohne weiteres anzuknüpfen, ein Recht, das man sich durch keine Kulturwandlungen nehmenlassen soll." (Keller, 1881)
Hertlings kritische Werkanalyse zeigt nicht nur Heinrich Lees frühe Realisierung der ästhetischen Diskrepanzen zwischen schöpferischer Phantasie und Imagination einerseits, entgegen einer scheinbar unbeugsamen Realität andererseits, sondern auch die Möglichkeit einer Vereinbarung beider Seinsebenen im Bereich der Landschafts- und Erzählmalereien. Es ist der poetische Realist, der sich letztlich das "Recht" aneignen kann, "auch im Zeitalter des Fracks und der Eisenbahnen, an das Parabelhafte, das Fabelmässsige ohne weiteres anzuknüpfen, ein Recht, das man sich durch keine Kulturwandlungen nehmenlassen soll." (Keller, 1881)