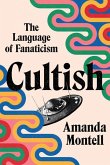In der modernen Öffentlichkeit wird die Stimme als das Medium einer demokratischen und sozialen Ordnung betrachtet. Sie steht im Zentrum eines umfangreichen Wortfeldes: Stimmrecht, Abstimmung, Volkes Stimme, eine Stimme haben oder die Stimme ergreifen. Ähnlich prominent ist die Stimme im übertragenen Sinne, in der gegenwärtigen Kultur- und Literaturtheorie. Sei es in der berühmten Frage: "Wer spricht?", im Konzept der Polyphonie oder der Intertextualität, in dem es um das Echo der Zitate in der Kunst geht. Was aber kommt zum Ausdruck, wenn "nur" die Stimme zu hören ist, wenn Klang, Rhythmus, Schrei, Atem und Stocken der Stimme jenseits aller Worte, aller Bedeutungen und Signifikate vernehmbar sind? Die langjährige monomanische Verehrung der Schriftreligion und Bildersucht durchbrechend, soll mit den hier versammelten Beiträgen eine Kultur- und Mediengeschichte der Stimme skizziert werden. Neben dem Verhältnis von Stimme und Schrift und der Rolle der Stimme in Politik und Jurisprudenz, gilt die Aufmerksamkeit vor allem Themenbereichen wie der Opern-, Musik- und Filmgeschichte sowie der Technikgenese modernerer Aufzeichnungssysteme.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Menschen, die ihre Stimme medientechnisch aufrüsten, um deren kollektive Wirksamkeit zu preisen, warnt Rezensent Jan Engelmann im Blick auf Adolf Hitler und John Farnham, ist nicht zu trauen. Mit der Kultur- und Mediengeschichte der Stimme beschäftigt sich nun der Tagungsband des Potsdamer Einstein Forums "Zwischen Rauschen und Offenbarung". Diskutiert wird nach Engelmann vor allem die Brisanz der Stimme im Doppelsinn von voice und vote. Claudia Schmölders relativiere die Bedeutung von Rundfunk und Lautsprecheranlagen für den Erfolg Hitlers: "Beides hat ihm - wie den anderen Diktatoren der Zeit - natürlich zum Durchbruch verholfen; aber demagogisches Charisma bedarf dieser Technik keineswegs, sondern wird auch und gerade in mikrosozialen Verhältnissen über unmittelbare Rede erlangt und stabilisiert", zitiert der Rezensent die Autorin. "Ironisch" findet Engelmann, dass Jacques Derrida seine sprachphilosophische Austreibung der (sich) selbstbewussten Stimme eben zu dem Zeitpunkt begann, als die Popmusik genau damit gegen die Einebnung der Vielstimmigkeit im politischen Prozess aufbegehrte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH