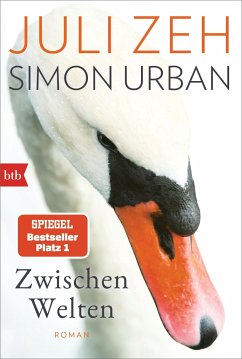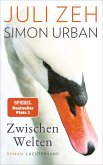Zwanzig Jahre sind vergangen: Als sich Stefan und Theresa zufällig in Hamburg über den Weg laufen, endet ihr erstes Wiedersehen in einem Desaster. Zu Studienzeiten waren sie wie eine Familie füreinander, heute sind kaum noch Gemeinsamkeiten übrig.
Stefan hat Karriere bei Deutschlands größter Wochenzeitung DER BOTE gemacht, Theresa den Bauernhof ihres Vaters in Brandenburg übernommen. Aus den unterschiedlichen Lebensentwürfen sind gegensätzliche Haltungen geworden. Stefan versucht bei seiner Zeitung, durch engagierte journalistische Projekte den Klimawandel zu bekämpfen. Theresa steht mit ihrem Bio-Milchhof vor Herausforderungen, die sie an den Rand ihrer Kraft bringen.
Die beiden beschließen, noch einmal von vorne anzufangen, sich per E-Mail und WhatsApp gegenseitig aus ihren Welten zu erzählen. Doch während sie einander näherkommen, geraten sie immer wieder in einen hitzigen Schlagabtausch um polarisierende Fragen wie Klimapolitik, Gendersprache und Rassismusvorwürfe. Ist heute wirklich jeder und jede gezwungen, eine Seite zu wählen? Oder gibt es noch Gemeinsamkeiten zwischen den Welten? Und können Freundschaft und Liebe die Kluft überbrücken?
Stefan hat Karriere bei Deutschlands größter Wochenzeitung DER BOTE gemacht, Theresa den Bauernhof ihres Vaters in Brandenburg übernommen. Aus den unterschiedlichen Lebensentwürfen sind gegensätzliche Haltungen geworden. Stefan versucht bei seiner Zeitung, durch engagierte journalistische Projekte den Klimawandel zu bekämpfen. Theresa steht mit ihrem Bio-Milchhof vor Herausforderungen, die sie an den Rand ihrer Kraft bringen.
Die beiden beschließen, noch einmal von vorne anzufangen, sich per E-Mail und WhatsApp gegenseitig aus ihren Welten zu erzählen. Doch während sie einander näherkommen, geraten sie immer wieder in einen hitzigen Schlagabtausch um polarisierende Fragen wie Klimapolitik, Gendersprache und Rassismusvorwürfe. Ist heute wirklich jeder und jede gezwungen, eine Seite zu wählen? Oder gibt es noch Gemeinsamkeiten zwischen den Welten? Und können Freundschaft und Liebe die Kluft überbrücken?
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Leben und Literatur gehören zusammen, sieht Rezensent Jakob Hayner bei Juli Zeh und Simon Urban: So schlagen die Wellen der digitalen Diskussion gleich wieder hoch, nicht immer fundiert, ein Thema, das sich auch im Roman "Zwischen Welten" prominent wiederfindet. Theresa, Bäuerin in Brandenburg, und Stefan, Journalist in Hamburg, kennen sich noch aus dem Studium, verrät der Rezensent, und führen jetzt eine Art digitalen Briefwechsel über aktuelle Aufregerthemen von Gendern bis Ukraine, wobei sie oft aneinandergeraten. Juli Zeh hat den richtigen Riecher für die Gegenwart, meint Hayner, vielleicht mehr als für die Sprache, er liest den Roman als wichtigen Debattenbeitrag zu moralischer Überheblichkeit und kluge Reflexion, die, auch wenn sie manchmal recht plakativ Feuilletonthemen aufgreift, ein großes Publikum findet wird, da ist er sich sicher.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Ein Zeitroman, der schon an der Nachbildung des Zeitgefühls scheitert: "Zwischen Welten" von Juli Zeh und Simon Urban
An Fans von Juli Zeh herrscht kein Mangel, und doch bewegt sich die Zahl der bei www.fanfiktion.de eingestellten Fortschreibungen ihrer Bücher einstweilen noch im niedrigen einstelligen Bereich. Zu "Zwischen Welten", Zehs jüngstem Roman, den sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Simon Urban verfasst hat, wünscht man sich ein Seitenstück in Gestalt einer fiktiven Besprechung aus der Feder von Dr. Renate "Reni" Werner. Sie ist eine Neben- oder eher Hintergrundfigur des Romans, eigentlich nur ein hingekritzelter Name auf der Potemkinschen Wand der biographischen Kulisse, vor der Zeh und Urban ihre Protagonisten postieren. Aber die achtlos erfundene Renate Werner wäre unzweifelhaft kompetent für die Abfassung einer Rezension, was die Form angeht ebenso wie den Stoff. Sie könnte was erzählen!
Denn in einem Seminar zur Erzähltheorie, das Frau Dr. Werner an der Universität Münster abhielt, begegneten sich um die Jahrtausendwende Theresa Kallis und Stefan Jordan, die in der Gegenwart des Romans, den neun Monaten zwischen dem 5. Januar und dem 4. Oktober 2022, erleben müssen, dass ihre Existenzen als brandenburgische Biobäuerin und hansestädtischer Kulturjournalist mitsamt den zugehörigen sozialen Welten zerbrechen, was sie in ausführlichen Briefen aneinander verarbeiten, verschickt und abgespeichert mittels der Formulare von E-Mail-Programmen und Messenger-Diensten. Der loyale Zeh-Fan, der sich unsere ausgedachte Schreibaufgabe vornähme, geriete gemeinsam mit der mutmaßlich um die verdiente Professur betrogenen Erzähltheorie- Spezialistin unweigerlich in einen Gewissenskonflikt: Renate Werner müsste bekennen, dass sie gescheitert ist und die beiden durchaus eifrigen Studenten mit einer in ihrer Studienzeit schon etwas altmodischen Vorliebe für Martin Walser in ihrem Seminar nichts über Erzähltheorie gelernt oder jedenfalls in der Zwischenzeit alles vergessen haben. Mit ergebener Fan-Phantasie ließe sich die mit diesem Befund konfrontierte Rezensentin als komische oder tragische Figur ausgestalten, und das Ergebnis könnte lustiger und rührender sein als alle Charaktermasken und Schicksalspuppen des Romanpersonals zusammen.
Nun wäre der Gegenstand der Besprechung unseres Gedankenspiels nicht der Briefwechsel, sondern das Buch, das aus den Briefen besteht. Und versuchsweise könnte man das Buch als Unbildungsroman lesen, in dem sozusagen zum ultimativen Beweis der Weltfremdheit aller Theorien, wie sie der Roman an den derzeit viel besprochenen Doktrinen der Antidiskriminierung und Inklusion vorführen möchte, die Erzähltheorie ihre Bedeutungslosigkeit für die Erzählpraxis offenbart. Die Reklamebehauptung aus den Geisteswissenschaften, dass ihr Studium dazu befähige, soziale Situationen zu lesen, wird durch Stefan, den Kulturchef einer Hamburger Wochenzeitung mit Kulturmissionsauftrag, scheinbar aufs Schönste widerlegt: Er sieht die Redaktionsintrige nicht, wenn sie sich vor seinen Augen abspielt und live in den sozialen Medien übertragen wird. Aber Stefans Blindheit wird nicht als Produkt literarischer Verbildung dargestellt, sondern erklärt sich ohne Rest moralisch, aus dem Dünkel des Karrieristen. Die handwerklichen Schwächen des Romans sind so eklatant, dass es schlichtweg keinen Spaß macht, erzählerische Absicht in einem irgendwie förmlichen Sinne zu unterstellen.
Man nehme nur die Stelle mit dem Seminar. Nach zwanzig Jahren haben sich die Kommilitonen und WG-Mitbewohner zufällig wieder getroffen, und in seiner zweiten E-Mail beschwört Stefan die Erinnerungen, die der Whatsapp-Kontakt mit Theresa in ihm wachgerufen hat: "Wir beide in Münster. Wie wir uns im Erzähltheorie-Seminar von Dr. Renate 'Reni' Werner kennengelernt haben."
Wenn Stefan und Theresa damals die Dozentin mit deren abgekürztem Vornamen bezeichneten, müsste dieser Spitzname als Trigger der Erinnerung genügen. Wie überhaupt die Authentizität der Reminiszenz durch Kürzel verbürgt werden müsste. Weißt du noch, damals, wir bei der Werner. Oder: In der Erzähltheorie ging es los. Man könnte sich auch die Bezeichnung des Seminarraums als Chiffre vorstellen oder ein Buch aus dem Handapparat. Bauformen des Erzählens. Urban und Zeh lassen Stefan im Duktus eines Lebenslaufs schreiben, damit der Leser weiß, woran er ist. Aber das ist Pseudoökonomie. Die Briefe werden unnötig lang und unnatürlich umständlich. Der Eindruck, dass Stefan und Theresa tatsächlich miteinander vertraut sind, kann erst gar nicht entstehen.
Für die allerkürzeste Erzähltheorie genügen zwei Wörter: weglassen und ausschmücken. Ein Erzähler sagt nicht alles, damit das, was er sagt, für sich spricht und auf anderes verweisen kann. "Zwischen Welten" ist eine Totgeburt, ein Fall von information overkill.
Ein zweites, ebenso unscheinbares Beispiel: "Ich kochte eine große Kanne Kaffee und schickte Eva mit dem Fahrrad zum Bäcker ins Nachbardorf." Das schreibt Theresa an Stefan in einer E-Mail mit Zeitstempel des 14. August 2022, 11.01 Uhr. Sie hat die ganze Nacht durchgearbeitet, in einer konspirativen Aktion. Mit jungen Öko-Aktivisten hat sie Gülle in Konservendosen abgefüllt, die Supermarktkunden untergejubelt werden sollen, um zu demonstrieren, dass der Zustand der Landwirtschaft zum Himmel stinkt. Und Theresa möchte Stefan zeigen, dass sein Engagement für den Klimaschutz Rhetorik ist. "Vielleicht solltest du das auch mal versuchen. Laberland verlassen und die Ärmel hochkrempeln." Eva, die Sprecherin der Aktivisten, holte Brötchen; das Gemeinschaftsfrühstück besiegelte den Gemeinschaftsplan. Dass frisches Backwerk am Sonntagmorgen erst im Nachbardorf zu bekommen ist, müsste für die Autorin der E-Mail selbstverständlich und für ihren Empfänger belanglos sein. Die Zusatzinformation ist an den Leser des Romans adressiert, dem das Ausmaß des Bäckereisterbens im Osten vor Augen geführt wird.
Dass getane Nachtarbeit euphorisierend wirkt und die Niederschrift eines Tätigkeitsberichts in betulichem Schulaufsatzstil ("Ich kochte eine große Kanne Kaffee" statt "Ich kochte Kaffee") inspiriert, mag man mit Ach und Krach noch irgendwie als möglich durchgehen lassen. Aber selbst die allerschlimmsten Ereignisse lösen in dieser Romanwelt einen ungehemmten Schreibfluss aus. Die für die elektronische Kommunikation typischen Abbrüche und Kurzschlüsse fehlen hingegen fast völlig. Als Stefan Theresa von einem Besuch bei der Familie seines Chefs berichtet, der wegen eines verunglückten Scherzes Opfer eines sozialmedialen Unflatgewitters geworden ist, schickt er der Schilderung der verheerten Seelenlandschaft der multikulturellen Musterfamilie eine Beschreibung der "Wahnsinnswohnung in Eppendorf" voraus, eingeschlossen die Nacherzählung eines dort verlebten Silvesterabends. Mit den plakativen Gegensätzen und melodramatischen Höhepunkten gäbe die Romanhandlung ein passables Drehbuch für eine Serie her. Im Film sähe man auf einen Blick, was hier beflissen aufgezählt wird, obwohl es dem mit dem Namen Eppendorf aufgerufenen Klischee entspricht: "Die Flügeltüren mit filigraner Holzsprosse, Originalverglasung und allerliebsten Buntglas-Ecken."
Stefan interpretiert die Szenerie für Theresa: Erst "auf den zweiten Blick entdeckte" er "Details, die eigentlich harmlos waren", aber "verstörend wirkten". Diese ominösen Einzelheiten sind dann geradezu lächerlich trivial: herumliegende Bücher, ein angebissenes Butterbrot. Details, die auf den zweiten Blick zu denken geben, ohne dass der Leser auf sie hingewiesen wird wie auf einer Führung bei Madame Tussauds, gibt es hier nicht. In der Romantheorie-Sitzung des Erzähltheorie-Seminars müssen Zeh und Urban gefehlt haben. Der Zeitroman, der das Buch sein will, scheitert sozusagen schon auf der Innenseite: Der Gang der Romanereignisse lässt kein Zeitgefühl aufkommen, weil die E-Mail-Botschaften den Datumszeilen zum Trotz ohne Zeitdruck verfasst scheinen.
Ereignisse aus der politischen Wirklichkeit unserer Zeit, hauptsächlich Auszüge aus den in Wochenzeitungen und sozialen Medien angezettelten Debatten, werden ebenso plump in den Text montiert wie die Bäckerei im Nachbardorf und der Spitzname von Frau Dr. Werner. Die Affäre um den Gender-Vortrag von Marie-Luise Vollbrecht wird sogar komplett hineinkopiert und lediglich von Berlin nach Hamburg verlegt. Einen Moment lang überlegt man auf den ersten Seiten noch, ob Münster als Studienort und das Erzähltheorie-Seminar als Schauplatz der Erstbegegnung der Hauptpersonen zu Ehren des Münsteraner Germanisten Moritz Baßler gewählt sein könnten, der Umberto Ecos Begriff "Midcult" als Etikett für die Gesprächsstoffhuberei zeitgenössischer Erfolgsromane populär gemacht hat. Aber die Welt von "Zwischen Welten" wurde gänzlich ohne auktoriale Ironie erschaffen, und auch Stefan Jordans kühne Idee für ein Alternativprojekt zum aktivistisch kastrierten Wochenblatt, "Keine Dauerpräsenz von Mode-Prominenten, ganz egal, wie stark sie gerade trenden", ist kein augenzwinkernder Gruß von Juli Zeh an ihre Fans unter den "Zeit"-Abonnenten.
Politisch gelesen, ergreift der Roman die Partei der abgefüllten Gülle, des pseudorealistischen Ressentiments gegen die jüngste Gestalt des vermeintlich abgehobenen Universalismus. Aber die WG-Ästhetik der erzählerischen Zweitverwertung mit ihren Bauformen vom Sperrmüll macht das reaktionäre Programm unschädlich.
Alles, was geschieht, ist bloß Anlass für Kommentare. Juli Zeh und Simon Urban haben sich urgemütlich eingerichtet im Laberland. PATRICK BAHNERS
Juli Zeh, Simon Urban: "Zwischen Welten". Roman.
Luchterhand Literaturverlag, München 2023.
448 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»So viel Gegenwart war selten in der deutschen Literatur.« Denis Scheck / Der Tagesspiegel