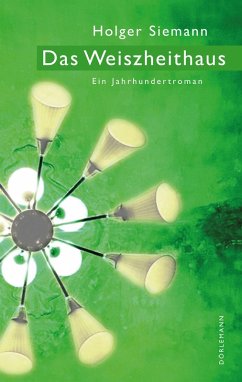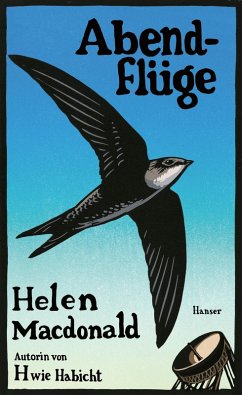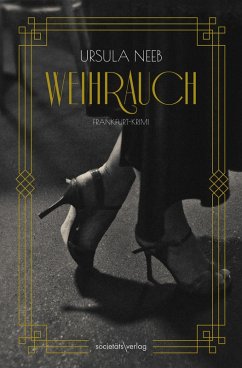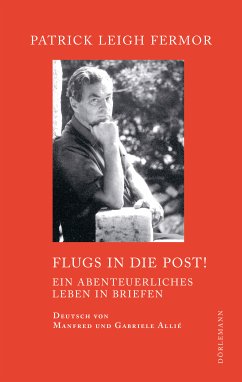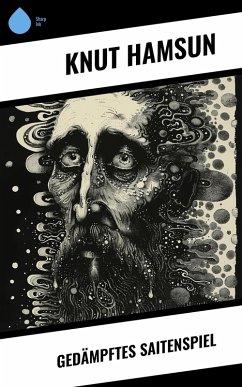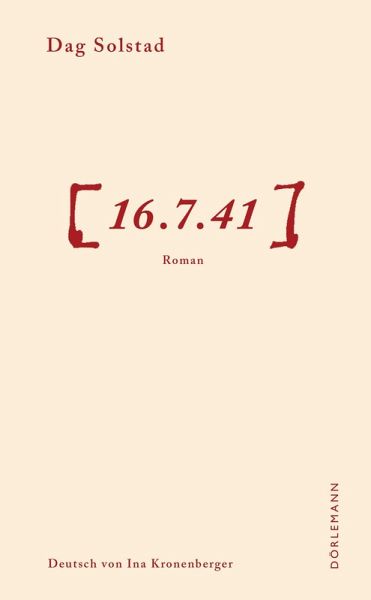
16.7.41 (eBook, ePUB)
Roman
Übersetzer: Kronenberger, Ina
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
18,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Dag Solstad selbst ist der Protagonist dieses Romans, der mit einem Flug nach Frankfurt beginnt. Solstad studiert beim Blick aus dem Fenster die Wolkenformationen: »Ich schaute auf die paradiesische Landschaft und fand es selbstverständlich, innerhalb dieses sphärischen Panoramas Engel, Fabelwesen und allegorische Vorstellungen zu sehen.«2001 wohnt Dag Solstad in einer Wohnung am Maybachufer 8 in Berlin. Auf Streifzügen durch die Berliner Straßen lässt sich auch der Autor Dag Solstad zunehmend einkreisen. Hier finden sich Momente des Glücks und der Ruhe, aber auch der Angst und der Ver...
Dag Solstad selbst ist der Protagonist dieses Romans, der mit einem Flug nach Frankfurt beginnt. Solstad studiert beim Blick aus dem Fenster die Wolkenformationen: »Ich schaute auf die paradiesische Landschaft und fand es selbstverständlich, innerhalb dieses sphärischen Panoramas Engel, Fabelwesen und allegorische Vorstellungen zu sehen.«2001 wohnt Dag Solstad in einer Wohnung am Maybachufer 8 in Berlin. Auf Streifzügen durch die Berliner Straßen lässt sich auch der Autor Dag Solstad zunehmend einkreisen. Hier finden sich Momente des Glücks und der Ruhe, aber auch der Angst und der Verzweiflung. Der Roman führt uns weiter nach Lillehammer und in sein Elternhaus in Sandefjord.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.