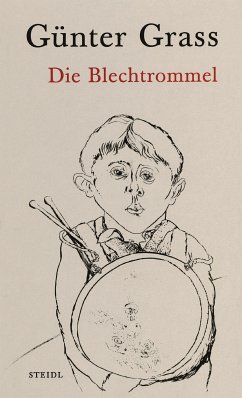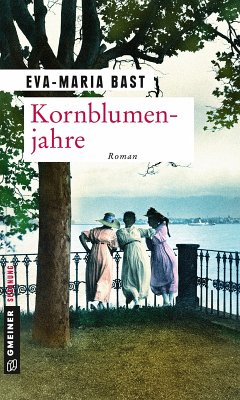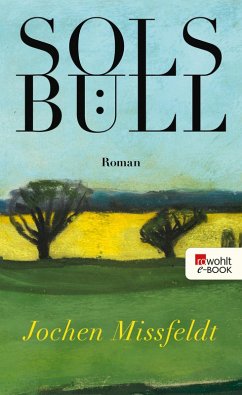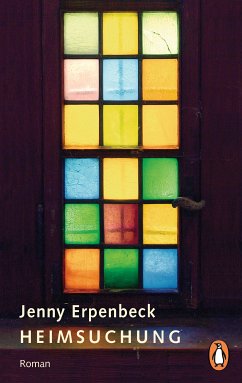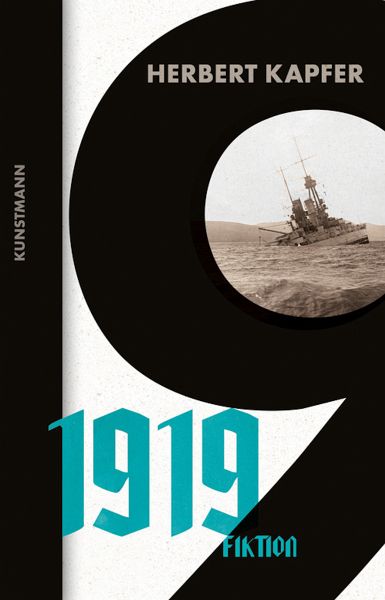
1919 (eBook, ePUB)

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
1919. Deutschland unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Aufstände. Räterepubliken. Freikorpskämpfe. Versailler Vertrag. Dolchstoß, politischer Mord, Revanche und Nazismus: Hätte Geschichte anders verlaufen können? Soldaten, Rückkehrer, Revolutionäre, Minister, Freikorpskämpfer, Gymnasiasten, Matrosen, Monarchisten, Vertriebene, Verliebte, ein Vagabund, eine Zeitungsverkäuferin: In ihren Geschichten präsentieren sich die tausendfachen Probleme einer Zeit, die von den Explosionen des Krieges erschüttert und von der katastrophalen Niederlage geprägt ist, von Hunger, Massenelend und ...
1919. Deutschland unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Aufstände. Räterepubliken. Freikorpskämpfe. Versailler Vertrag. Dolchstoß, politischer Mord, Revanche und Nazismus: Hätte Geschichte anders verlaufen können? Soldaten, Rückkehrer, Revolutionäre, Minister, Freikorpskämpfer, Gymnasiasten, Matrosen, Monarchisten, Vertriebene, Verliebte, ein Vagabund, eine Zeitungsverkäuferin: In ihren Geschichten präsentieren sich die tausendfachen Probleme einer Zeit, die von den Explosionen des Krieges erschüttert und von der katastrophalen Niederlage geprägt ist, von Hunger, Massenelend und Kriegsgewinnlern, von fanatischem Nationalismus und sozialrevolutionären Ideen, von militärischer Gewalt und Fantasien freier Liebe. In 1919 fließen Hunderte von Splittern, Szenen und Handlungsverläufen aus zeitgenössischen Romanen, Berichten und Aufsätzen zusammen. Ein Erzählstrom in 123 Kapiteln, der aus den Ideen und Kämpfen der Zeit schöpft, aus trivialen, völkischen, utopischen, dadaistischen, reaktionären, politischen, literarischen und fotografischen Quellen. Ein Spiel mit historischen Möglichkeiten und literarischen Figuren, imaginierten Geschichten und realen Ereignissen, kollektivem Wahn und individuellen Wirklichkeiten. Eine Fiktion, die extreme Positionen vorführt und die Widersprüche der Weimarer Republik zuspitzt, die von Kaiser Wilhelms Glück und Ende erzählt, von der Bruderschaft der Vagabunden und dem Untergang einer Flotte, von den Träumen der Kunst und der Rückkehr deutscher U-Boote. Ein kühnes, überraschendes, ungeheuerliches Werk wider Geschichtsvergessenheit, Fatalismus und blinden Gehorsam. Ein wegweisendes Buch über ein Weltende, das eine Zukunft war.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.