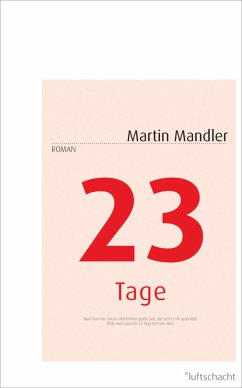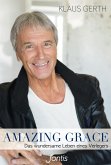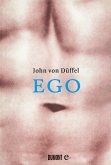Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Die Leiden eines jungen Freiberuflers: Martin Mandler hört mit seinem Debütroman "23 Tage" auf neoliberale Befindlichkeit.
Man weiß noch, wie es war, wenn man als Schüler krank darniederlag und eine, vielleicht zwei Wochen zu Hause blieb. Während die Grippe schwand, wuchs ein anderes Unwohlsein: die Mutlosigkeit vor dem ersten Schultag danach, der zur unüberwindlich scheinenden Schwelle wurde. Das Gefühl, den Anschluss an den sozialen Kosmos Schule verloren zu haben. Nicht mehr hart genug zu sein für die kleinen Angriffe, gegen die man vorher immun gewesen war. Und für das Leistungsprinzip, das nicht, wie die besorgte Mama, nach Befindlichkeiten fragt.
Der namenlose Held in Martin Mandlers Debütroman "23 Tage" ist von dieser Melancholie des Daheimgebliebenen befallen. Zärtlich beschreibt er das idyllische Eifelhäuschen, in dem er mit seiner langjährigen Freundin Laura wohnt. Doch Laura bricht aus der weichgepolsterten Zweisamkeit aus und fliegt für dreiundzwanzig Tage nach London. Es ist der Anfang vom Ende dieser schon lange bröckelnden Beziehung.
Der Erzähler bleibt im Biedermeier zurück, Gesellschaft leisten ihm nur die Dinge. Rührend beschreibt er die zärtliche Vertrautheit mit der Kaffeemaschine, die Zuneigung zu einer alten Tasse. Lichtblicke in seiner Einsamkeitsverstrickung sind selten, auch wenn er gar nicht viel verlangt: Schon ein kurzes Zigarettengespräch an der Bushaltestelle stimmt ihn euphorisch, weil es ihn aus sich herauszieht, "mich beinahe rechtfertigt, mir für einen Augenblick das Gefühl gibt, in der Welt angekommen zu sein".
Um dieses Rechtfertigungsbedürfnis vor der Welt geht es dem 1978 geborenen Österreicher Mandler. Wie sein Erzähler lebt er in der Eifel und kennt als Autor und Kreativdirektor wohl auch dessen Form der Berufstätigkeit: Mandlers Held lebt von gelegentlichen Aufträgen in der Kreativbranche, doch sein freies Arbeitsleben ist jenseits aller Hipness. Auch in Berlin, wohin er für ein paar Tage fährt, um sich vom Sehnsuchtsschmerz abzulenken, scheint die apfelfrische digitale Boheme weit entfernt. Auf der Suche nach Halt macht er jede noch so kleine häusliche Verrichtung zum Ritual. Mandler schildert das in meditativen Sätzen: "Ich werde mich duschen. Ich werde mir die Nägel schneiden. Ich werde mich kämmen."
Zu seinem Unglück ist Mandlers Held auch noch so klug, dass er sich bei diesen Techniken der Selbstvergewisserung ertappt: "Ich ekle mich vor mir, weil ich doch nur wieder mir selbst aufsitze, weil ich mir wieder einmal einzureden versuche, dass etwas ganz Alltägliches in meinem Leben einen größeren Sinn haben, es eine höhere als die bloß praktische Bedeutung besitzen könnte. Wieder einmal versuche ich meine Nichtigkeit aufzublasen, um am Ende jemand zu sein." Die große Stärke dieses Buchs ist der übergenaue Nachvollzug der Gedankengänge, ihr gewundener, aber zwangsläufiger Weg vom Pathos zur Selbstentlarvung.
Herausgelöst aus allen stabilisierenden Kontexten, leidet der erschöpfte Freiberufler am Ungenügen gegenüber der totalen Freiheit, die eben auch ein totaler Anspruch ist. Eine Welt, die keine festen Wege mehr vorgibt, die im Gegenteil größtmögliche Offenheit propagiert, fordert nur mehr eines, das aber vehement: Initiative! Die verkörpert Lauras Exfreund, den sie in London besucht. Brad Silverfield, der Rivale, ist alles, was der Erzähler nicht ist. Er ist stark und originell und doch nicht so sehr, als dass er seinen Platz in der Welt vor lauter Besonderssein nicht gefunden hätte. "Er ist involviert, dieser Medienbrad", er wird auf der Straße erkannt, "und er ist gefragt".
Der schmale Roman ist ein Porträt jener Jahrgänge von den späten Siebzigern an, die seit ihrer Jugend gesagt bekommen, dass sie alles werden könnten. Dass die Schranken der Geschlechterrollen und der Herkunft gefallen seien. Diese luftigleichte Verheißung jedoch senkt sich mit den Jahren herab und wird zur Last. Wenn man alles werden kann, muss man etwas Besonderes werden. Die Crux mit der neoliberalen Freiheit ist, dass sie Segen und Fluch, Angebot und Gebot zugleich ist. Als der Erzähler London unverrichteter Dinge verlässt, beschließt er, sich eine Festanstellung zu suchen. Wovon die Kreativarbeit befreien sollte, nämlich täglich neun Stunden im Büro zu verbringen, das erscheint nun als die Erlösung von allem Übel.
Vielleicht möchte man am Ende dieses therapeutischen Selbstgesprächs den Erzähler schütteln, ihm sagen, dass er wohlstandsverzärtelt sei. Doch auch diesen Vorwurf denkt dieser hochreflektierte Roman immer schon mit: "Und ich frage mich, ob das tatsächlich sein kann, dass man falsch fühlt, dass der eigene Kummer falsch sein kann, dass er an der Welt vorbeigeht, vielleicht. Dass er sich verläuft und übers Ziel hinausschießt."
Darin besteht die Ehrlichkeit von Mandlers Debüt: in der gesteigerten Aufmerksamkeit den eigenen Regungen gegenüber, die eben nicht zu haben ist, ohne dass man mit großer Schonungslosigkeit um sich selbst kreist. Wie ein Schulkind, das in seinen Halsschmerz hineinhorcht und sich fragt, ob es morgen wieder in die Schule gehen kann. Was sowohl Kränkung wie Heilung sein wird.
KATHLEEN HILDEBRAND
Martin Mandler: "23 Tage". Roman.
Luftschacht Verlag, Wien 2011. 144 S., geb., 18,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH