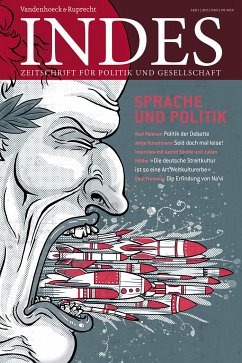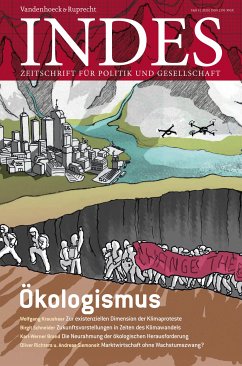50 Jahre Bundesrepublik Deutschland (eBook, PDF)
Rahmenbedingungen - Entwicklungen - Perspektiven
Redaktion: Ellwein, Ingrid; Holtmann, Everhard
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 59,90 €**
46,99 €
inkl. MwSt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
23 °P sammeln!
Aus politischer Sicht wird in dem Sonderheft der 'Politischen Vierteljahresschrift' eine Bilanz der vergangenen 50 Jahre der Bundesrepublik gezogen. Der Band umfasst mehr als 40 Einzelbeiträge, die, in der Form knapper wissenschaftlicher Essays, in insgesamt 6 Abschnitten zusammengefasst werden: Entwicklungsgeschichte der Bundesrepublik und der DDR, Verfassung und Verfassungswandel, Kontinuität und Veränderung der öffentlichen Aufgaben. Die Gebietskörperschaften und ihre Verflechtung, Institutionen und Verfahren der Politik, Akzeptanz und Erneuerung.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.