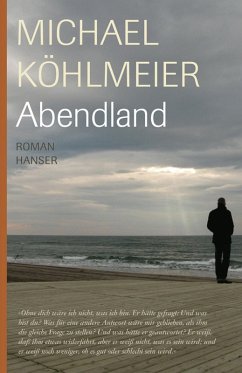Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Von einem, der auszog, die Zeit einzufangen: Michael Köhlmeiers Jahrhundertroman "Abendland" / Von Felicitas von Lovenberg
In diesem Roman fühlt man sich gut aufgehoben, es herrscht eine Vertrautheit wie in guter Gesellschaft.
In einer der stillschönsten beiläufigen Szenen dieses Romans wartet ein kleiner Junge, der zum Schriftsteller heranwachsen wird, den ganzen Sommer lang sehnsüchtig darauf, dass der Kirschbaum, dessen Ast bis an sein Fenster reicht, endlich Früchte trägt. Aber die Amseln holen sie, noch ehe sie reif sind. Da kauft sein Vater auf dem Markt Kirschen, hängt sie an die Zweige, "kitzelte mich wach und sagte, es habe sich ,ein Naturwunder ereignet', der Baum habe über Nacht Kirschen wachsen lassen, ,extra für dich', was sich damit beweisen lasse, ,dass sie ausschließlich an dem Ast vor deinem Fenster wachsen'".
Einem mit Erkenntnisäpfeln und Lesefrüchten eigens für uns beladenen Baum ähnelt auch Michael Köhlmeiers Roman, dessen Wurzeln tief in die humanistische Tradition hinabreichen und in dessen ausladender Krone Friedells "Kulturgeschichte der Neuzeit" ebenso einen Ehrenplatz hat wie Spenglers "Untergang des Abendlands", Doderers "Strudlhofstiege" ebenso wie Prousts "Recherche" - und was dergleichen namensstarke, doch letztlich unergiebige Vergleiche mehr sind.
Wenn es um Bücher geht, kann man immer wieder hören und lesen, dieser Roman oder jenes Gedicht sei "gut gemacht": ein Milieu sei charakteristisch beschrieben, ein Gefühl beschworen, ein Ton getroffen, eine Handlung spannend konstruiert. Nun ist alle Literatur Kopfarbeit und Handwerk, und insofern ist "gut gemacht" fast immer als Lob gemeint. Und doch - mit großer Literatur hat das derart Getätschelte selten etwas zu tun. Wem kommt bei der Lektüre Tolstois oder Dostojewskis, bei Kafka oder Joseph Roth schon dauernd der Gedanke, wie "gut" das "gemacht" ist? Dass wahre Kunst notwendigerweise größer ist als ihr Urheber, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile - das macht sie aus. Gut Gemachtes kann man gern lesen und sogar bewundern, aber es hinterlässt keine Spuren.
Die schiere Absicht, einen Jahrhundertroman schreiben zu wollen, dürfte in den meisten Fällen schon genügen, den Plan scheitern zu lassen. Doch bei Michael Köhlmeier wird schnell deutlich, dass der Roman mit dem Autor durchgegangen ist, dass jeder Plan, wie das zwanzigste Jahrhundert mit Hilfe der engverknüpften Biographien zweier Männer in einen Roman gezwungen werden kann, immer wieder verändert und angepasst werden musste. Das hat zunächst Vorteile, die sich im Laufe des Romans jedoch gegen ihn wenden: Die ersten dreihundert Seiten liest man mit Euphorie, die nächsten dreihundert mit Bewunderung und einsetzender Übersättigung und die letzten hundertsiebzig, weil man zum Schluss kommen möchte. Dennoch fühlt man sich in "Abendland" aufgehoben, es herrscht eine Vertrautheit wie in einem ansprechenden Heim oder in guter Gesellschaft, ein instinktives Verstehen, das nichts mit den Schauplätzen oder gar dem gepflegten, tief europäischen Ton der Vergeblichkeit zu tun hat, sondern mit der anregenden, wunderbaren und keineswegs häufigen Gewissheit, es hier mit wahrer Literatur zu tun zu haben.
Denn vom ersten Satz an und über die ganzen 775 Seiten hinweg atmet "Abendland" die Gegenwart eines leidenschaftlichen, geborenen Erzählers, und diese Qualität lässt das Gemachte verschwinden und die Kunst zum Vorschein kommen. Das lässt sich nicht erzwingen. Es geschieht - oder es bleibt aus.
Abendland" ist ein Entwicklungs- und Bildungsroman, die Geschichte zweier Familien, deren Mitglieder einander lieben, doch nicht glücklich machen können. Erzählt wird die Geschichte einer Auftragsbiographie. Sebastian Lukasser, ein Schriftsteller in den mittleren Jahren, der seit einer Prostata-Operation an Inkontinenz leidet, wird vom seinem sterbenden Patenonkel zu dessen Eckermann bestellt. Carl Jacob Candoris war in seinem fünfundneunzigjährigen Leben vieles: der dandyhafte Erbe der vom Großvater gegründeten Wiener Feinkost- und Kolonialwarenhandlung "Bárány & Co.", ein hochbegabter Mathematiker, ein früher Freund des Jazz. Ein Schutzengel der Familie Lukasser, ein Doppelmörder, der Ehemann der gefühlsstarken Portugiesin Margarida. Als Junge begegnet er der jüdischen Philosophin Edith Stein, als junger Mathematiker forscht er im Kreis der großen Wissenschaftlerin Emmy Noethen. Nachdem er in Los Alamos Oppenheimer bei der Entwicklung der Atomwaffen zugesehen hat, ist Candoris als Freund des homosexuellen New Yorker Psychologen Abraham "Abe" Fields bei den Nürnberger Prozessen zugegen.
Candoris sammelt interessante und begabte Menschen. So hat er auch George Lukasser, Sebastians Vater, aufgelesen: Im Wiener Embassy-Club hört er den kleinen, drahtigen Mann eines Abends mit seiner Contragitarre musizieren und hat "das angenehm unangenehme Gefühl, doch so etwas wie Seele zu besitzen" (ein Satz, in dem das Mephistophelische dieser schillernden Figur erstmals aufscheint). Candoris vermittelt seinem Schützling Auftritte und Kontakte, schließlich sogar den zu seiner späteren Frau, Sebastians Mutter: So ist er, als Entdecker, Förderer und Mitbestimmer, in dessen Leben von Anfang an präsent; ein begnadeter Bewunderer, der vom Genie anderer zehrt. George Lukasser, der krummbeinige und dem Alkohol zuneigende Sohn eines Wiener Schrammelmusikanten, ist in seiner sich dem Schicksal ausliefernden Hilf- und Ziellosigkeit der Gegenentwurf zu seinem alle Umstände und Personen berechnenden Freund Candoris, der sich ohne Skrupel über die Menschen stellt und in deren Leben eingreift.
Seinen Patensohn Sebastian zitiert er - mittlerweile schreiben wir das Jahr 2002 - in seine Villa bei Lans, wo er ihm aus seinem Leben berichtet, auf dass er es "nacherzähle". Wo Carl Candoris das Alter in den Arm fällt, übernimmt Sebastian den Part, das Jahrhundert biographisch zu spiegeln. Er ist der Ich-Erzähler des Romans, den die Lebensbeichte Candoris' zur Vergegenwärtigung seiner eigenen Stationen veranlasst: Das Studium in Frankfurt katapultiert ihn von den Auseinandersetzungen der Achtundsechziger auf Umwegen in die Nähe der RAF, vor allem jedoch in eine Ehe, vor deren Kompliziertheit er ebenso wegläuft wie vor seiner Vaterschaft. Erst als Sebastian sich für einige Jahre vom Übervater Carl lossagt, gelingt ihm der Absprung: In Amerika verliebt er sich in eine ältere Frau und hat erste Erfolge als Autor von fiktionalisierten Musikerbiographien - übrigens eines der vielen Genres, in denen sich auch Köhlmeier schon ausprobiert hat. Die Lust daran, durch überraschende Konstellationen Parallelen und Gegenströmungen aufzudecken, Fakten und Fiktion spielerisch ineinander übergehen zu lassen, treibt diesen Autor an - und damit auch die Frage, ob jedes Leben, jeder Roman nicht auch einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können.
Es geschieht so viel in diesem Buch, dass kaum auffällt, dass die eigentliche Handlung, ein Kammerspiel zweier kranker Männer mit einer Haushälterin, auf ein Minimum zurückgenommen ist. Der Roman erzählt nicht weniger als eine Ideen- und Wissensgeschichte des letzten Jahrhunderts, dessen ganze Tragik, Komik und Lakonik sich an den Figuren vollzieht. Was die drei männlichen Protagonisten an Erfahrungen nicht mehr schultern können, wird den Nebenfiguren aufgepackt. Und in diesem unbedingten, sich nicht bremsen könnenden Anspruch auf Vollständigkeit der Themen und Konflikte taucht dann schließlich doch ein Muster, eben eine Machart auf, die zwar kein historisches Detail auf der langen Strecke vergisst, dafür aber ihre literarische Motivation.
Die Frage, warum wir all diese Einzelheiten über einen Mann erfahren, der letztlich dennoch kein anderes Profil als das eines äußerlich teilnehmenden, innerlich distanzierten Beobachters gewinnt, bleibt ohne Antwort - beziehungsweise erschöpft sich in einem Urteil, das George Lukasser bereits auf der zweiten Seite über seinen Gönner fällt: "Seine Eitelkeit ist zugegebenermaßen raffiniert." Und so wohltuend der gelassene, sich mit großer Souveränität Zeit und Raum nehmende Gestus ist, mit dem zu immer neuen Wendungen in den Biographien der Figuren ausgeholt wird - so zunehmend misstrauisch machen sie und schließlich auch müde. Natürlich geht es nicht darum, aus allem Schlüsse zu ziehen, und die Tatsache, dass Köhlmeier zwar einen höchst psychologischen, doch keinen psychologisierenden Roman geschrieben hat, zählt zu den besonderen Stärken des Werks.
Was aber unerfüllt bleibt, ist der eine große, berechtigte Wunsch des Lesers: jener nach einer Offenbarung. Von einem kleineren, bescheideneren Roman würde und dürfte man eine solche nicht erwarten, aber ein Roman dieses Kalibers und dieses Anspruchs drängt diese Hoffnung geradezu auf. Stattdessen verschwinden die Charaktere mehr und mehr hinter ihrem Jahrhundert, das am Ende als eigentliche Hauptfigur dasteht. Sebastian benennt die Krux dieses Romans, als er einmal seine Schreiberfahrungen zusammenfasst: "Die Recherche ist ein Hund, das hatte ich bei dieser Gelegenheit gelernt. Für den Schriftsteller kann sie zu einem bissigen Hund werden. Der gibt sich zuerst spiellustig, tut, als ließe er sich abrichten, sorgt für Erfolgserlebnisse bei seinem Herrn, und zuletzt zerfetzt er seine Geschichte."
Gelungen sei eine Geschichte dann, räsoniert Sebastian ein anderes Mal, "wenn sie gebaut ist wie das Leben". Nun bietet das Leben keineswegs immer befriedigende Erklärungen oder gar Abschlüsse für seine Volten an. Dazu braucht es einen Erzähler, der die geheimen Parallelen, die nur scheinbar losen Zusammenhänge sichtbar werden lässt - eben jemanden, der Kirschen an die dürren Zweige hängt und der Natur so ein bisschen nachhilft. Michael Köhlmeier hat köstliche Kirschen für uns gepflückt. Leider hat er den Ast überladen.
Michael Köhlmeier: "Abendland". Roman. Hanser Verlag, München 2007. 775 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main