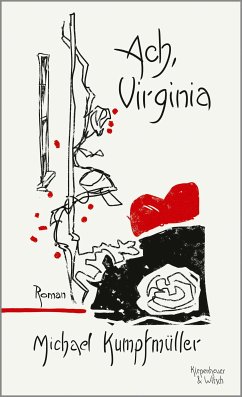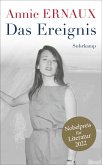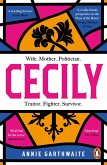Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Wortloses Flüstern: Michael Kumpfmüller beschreibt die letzten Tage der Schriftstellerin Virginia Woolf
März 1941, ein großer Garten mit bescheidenem Anwesen am Rande eines malerischen Dörfchens, der Kirchhof direkt nebenan, gelegen im Südosten Englands, unweit der Küste. Frühling liegt fast in der Luft, doch die Tage sind noch unbeständig, windig, die Nächte kalt und laut. Dröhnend fliegt die deutsche Luftwaffe am Himmel ihre Angriffe auf London. Wer kann, hat die Ruinenmetropole längst verlassen, so auch das Schriftsteller- und Verlegerehepaar Leonard und Virginia Woolf, die ihre Stadtwohnung verloren und sich ins Landhaus nach Rodmell zurückgezogen haben. Dem Krieg aber entkommen sie hier nicht.
Virginia, eine passionierte Londonerin, sehnt sich nach den Klangräumen der Großstadt. In Rodmell, schreibt sie, "gibt es kein Echo - nur schale Luft". Ein schlankes Romanmanuskript hat sie grad fertiggestellt und einem Verlegerkollegen zur Begutachtung geschickt, für die weitere Bearbeitung jedoch fehlt ihr die Kraft. Die Depression, mit der sie seit Jahrzehnten lebt, nimmt immer fordernder Besitz von ihr. Drei Abschiedsbriefe schreibt sie und einen letzten Tagebucheintrag: "Heute ein seltsames Meeresküstengefühl in der Luft. Es erinnert mich an Pensionen auf der Promenade zu Ostern. Alle lehnen sich gegen den Wind, starr vor Kälte & zum Schweigen gebracht. Das Mark entfernt." Und dann, noch rätselhafter: "Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn wir Seelen einflößen könnten." Am 28. März packt sie sich schwere Steine in die Manteltaschen und geht in den Fluss. Drei Wochen später findet man die Leiche.
Das Leben wie das Sterben dieser großen Schriftstellerin, die für die Moderne das Erzählen neu erfunden hat, ist durch ihre vielen Selbstzeugnisse ungewöhnlich gut bekannt. Aber können uns die hinterlassenen Schriftstücke wie auch die Aussagen des Umfelds jemals der eigentlichen Person nahebringen, dem Schöpferischen, das sie angetrieben, oder gar dem Selbstzerstörerischen, das sie umgetrieben haben muss? Wollen wir ihr überhaupt auf diese Weise wahrhaft nahekommen? Oder worin sonst könnte Erzählliteratur, die immer die Lizenz zum Lügen hat, ihre eigene Wahrhaftigkeit je finden? Diesen Fragen geht Michael Kumpfmüller im neuen Roman nach, seinem siebten. Nichts Geringeres nimmt er sich darin vor, als die denkwürdige Vorstellung, die Woolf zuletzt im Tagebuch festhält, nun auf sie selbst anzuwenden: ihr eine Seele einzuflößen. Kann das gelingen?
Den zehn letzten Lebenstagen folgt der Roman, allesamt genau datiert und mit den wirklichen Geschehnissen, soweit bekannt, akribisch unterfüttert. Wir lesen, wie der schreckens- und entbehrungsreiche Kriegsalltag das Leben immer stärker in Beschlag nimmt; wie Freundschaften und andere Gesellschaftsbindungen, die Woolf ein Lebenselixier gaben, keinen Raum mehr finden und auch den intellektuellen Austausch lahmlegen; wie ihr Eheleben, das mit sogenanntem "Kopulationskram" mutmaßlich noch nie etwas zu tun hatte, doch ein paar zärtliche Momente gewinnt; wie Erinnerungen an Geschriebenes und viel Gelesenes wellenförmig auf- und abtauchen. Vor allem aber lesen wir, wie Woolf den zahlreichen Verstorbenen, die sie schon lang begleiten, noch einmal begegnet: Familienangehörigen wie dem Bruder Thoby, der jung an Typhus starb und im Roman "Jacobs Zimmer" weiterlebt, Künstlerfreunden wie Mark Gertler, der den Kopf ins Gas gelegt, oder der Freundin und Rivalin Katherine Mansfield, der ein Lungenleiden früh das Weiterleben erspart hat - ein verführerischer Totentanz, der auch Woolf bald unaufhaltsam mitreißt.
Erzählt wird das alles in der dritten Person in einer Art Bewusstseinsstrom, der spürbar Woolfs eigener berühmter Erzähltechnik nachgestaltet ist, hier durchsetzt von realen Tagebucheinträgen sowie Briefen und nur gelegentlich durch kurze Gegenschnitte auf eine Außenperspektive unterbrochen. Erst ganz zum Schluss verschiebt sich der Beobachtungswinkel und gibt noch einen Blick auf Leonard und sein Weiterleben frei. Tadellos recherchiert und mit vielen Resonanzen aus Woolfs Texten angereichert, schafft der Roman auf diese Art gekonnt die Echokammer, die Woolf in Rodmell so vermisste. Und doch liest man ihn mit großem Unbehagen.
Vor knapp zehn Jahren gelang Kumpfmüller ein genialer Wurf. In "Die Herrlichkeit des Lebens", der zum Bestseller wurde, entwarf er ein Bild des letzten Lebensjahres von Franz Kafka, leichthändig, hell und heiter und trotz tödlicher Tuberkulose von überraschender Lebensfreude erfüllt. Jetzt, da der Autor sich mit Virginia Woolf an eine andere Literatur-Ikone der Moderne wagt und ihre letzten Tage nachzeichnet, bleiben Überraschungen weitgehend aus. Am eindringlichsten sind seine Erzählpassagen, wenn Innenwelt und Außenwelt in eins zu gleiten scheinen, anderes wirkt eher zudringlich ("und so beugen wir uns ein wenig vor, damit wir besser hören, welche Geräusche sie macht"). Der schon oft ausfabulierten Idee, dass der bedeutsamste Moment in Woolfs Leben ihr Tod und in Freitodfiguren wie Septimus aus "Mrs Dalloway" vorgefasst sei, hat er nur wenig hinzuzufügen. Stattdessen solche Sätze: "Sie möchte dem Fluss eine schöne Geliebte sein, jung und geschmeidig; sie möchte, dass er sie sieht und birgt, nackt und entgegenkommend, wie sie jetzt ist. Ja, Liebster, sagt oder flüstert sie, so man wortlos flüstern kann, und man scheint es zu können." Das ist abgeschmackte Wasserleichenlyrik.
Wer Lust auf Woolf in biographischen Fiktionen hat, der lese lieber "Mitz, das Krallenäffchen von Bloomsbury" von der New Yorker Autorin Sigrid Nunez (auf Deutsch leider nicht mehr lieferbar), die ebenso charmante wie beziehungsreiche Geschichte eines ungewöhnlichen Haustiers, das frischen Wind ins Leben der Woolfs bringt. Dagegen fühlt sich "Ach, Virginia" eher an wie schale Luft.
TOBIAS DÖRING
Michael Kumpfmüller: "Ach, Virginia". Roman.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2020. 238 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main