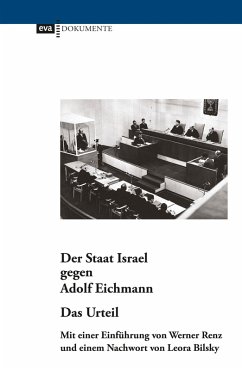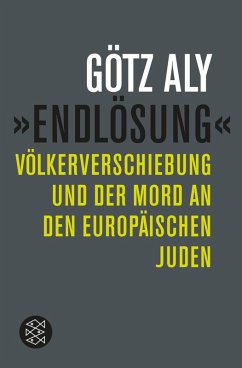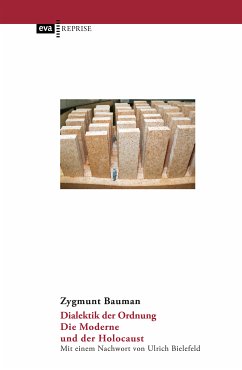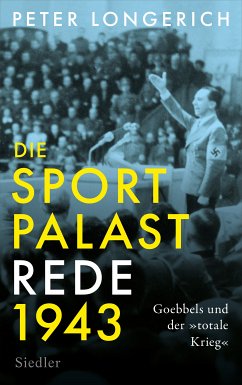ad Hannah Arendt - Eichmann in Jerusalem (eBook, ePUB)
Die Kontroverse um den Bericht "von der Banalität des Bösen"
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 18,00 €**
7,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Bei Arendts Bericht über den Eichmann-Prozeß« handelt es sich »um eine nachgerade apokryphe Schrift [...], in der bei weitem mehr abgehandelt wird als der nationalsozialistische Judenmord allein.« (Dan Diner) Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess hat in den 1960er Jahren eine Kontroverse entfacht. Insbesondere frühere Repräsentanten der Juden in Deutschland haben gegen das Buch polemisiert, Arendt gar eine »Kriegserklärung« (Siegfried Moses) ins Haus geschickt. Auch das von Arendt so genannte jüdische Establishment in den USA und in Israel organisierte gegen die Autori...
»Bei Arendts Bericht über den Eichmann-Prozeß« handelt es sich »um eine nachgerade apokryphe Schrift [...], in der bei weitem mehr abgehandelt wird als der nationalsozialistische Judenmord allein.« (Dan Diner) Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess hat in den 1960er Jahren eine Kontroverse entfacht. Insbesondere frühere Repräsentanten der Juden in Deutschland haben gegen das Buch polemisiert, Arendt gar eine »Kriegserklärung« (Siegfried Moses) ins Haus geschickt. Auch das von Arendt so genannte jüdische Establishment in den USA und in Israel organisierte gegen die Autorin eine regelrechte Kampagne. Monatelang erschienen in Zeitungen und Zeitschriften kritische Artikel und Aufsätze. Die deutsche Ausgabe wollten ihre Gegner verhindern. Sie behaupteten, das Buch richte in Deutschland großen Schaden an und lasse Nazismus und Antisemitismus wieder aufleben. Arendts kritische Darstellung der Anklagevertretung, ihre Bedenken gegen die Instrumentalisierung des Prozesses durch die Ben-Gurion-Regierung, ihre Kritik an der »jüdischen Führung« zur Zeit der sogenannten »Endlösung der Judenfrage«, ihre Ausführungen zur »Kooperation« der Judenräte mit den deutschen Mördern, ihr von Eichmann gezeichnetes Bild, den sie einen »Hanswurst« nannte, lösten Empörung aus. In der Bundesrepublik stieß ihre Darstellung des deutschen Widerstands, ihre Beurteilung der inzwischen verehrten »Männer des 20. Juli«, auf Ablehnung. Unbeachtet blieb indes Arendts vehemente Kritik am Adenauer-Staat, an der unzureichenden justiziellen Aufarbeitung der NS-Verbrechen, an der verlogenen Geschichtspolitik von »Nach-Hitler-Deutschland«. Arendt sprach von der »unbewältigten Vergangenheit« von Deutschen und Juden. Ein Thema, das heute noch zur Debatte steht.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.