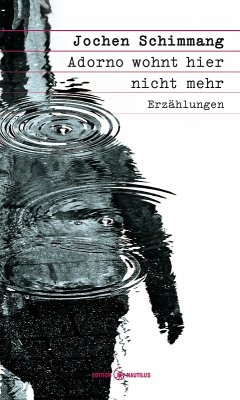Vor 50 Jahren, im August 1969, starb Adorno - und Jochen Schimmang übt sich in Abwesenheitsp¿ege. In melancholischen bis heiteren, zum Teil autobiogräsch gefärbten Geschichten erzählt er von Formen und Figuren des Verschwindens. Von Menschen, Gebäuden, ganzen Vierteln; von Techniken, Gesten, Sprechweisen. Ein Jubilar versteckt sich mit seiner Frau auf dem Dachboden vor seinen Freunden, die zum 70. Geburtstag aus allen Himmelsrichtungen auf ihn einstürmen, obwohl er viel lieber nur mit zweien von ihnen essen gegangen wäre. Rothermund macht sich auf die Suche nach dem verschwundenen Maler Guthermuth. Ein Spaziergang durch Frankfurt zeigt, wer, außer Adorno, noch alles nicht mehr dort wohnt. Aber Spaziergänge sind ohnehin sterbende Institutionen, ein Sich-Verirren in der Welt kann zum Verwirren der Welt werden. Milieus, die sich nicht mehr erreichen, Nomaden in Monaden. Nur Gott ist nicht verschwunden, er taucht pünktlich um halb sieben in der Kirche auf - im Fischgrätmantel. Jochen Schimmangs feinsinnige Erzählungen gehen auf Spurensuche nach Lücken und Verlusten und zeigen zugleich, dass "Identität" eine höchst fragile Konstruktion ist.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

"Adorno wohnt hier nicht mehr": Die melancholischen Geschichten von Jochen Schimmang sind zärtlich und gewitzt erzählt.
Wer auf ein längeres Leben zurückblickt, wird zunehmend darüber staunen müssen, was er alles nicht mehr ist. Obwohl das, was er einmal war, fraglos zu seiner Identität gehört. Aber inwieweit stimmt das? Wir können nicht mehr als Kinder sterben. Intime Zugänge zum Vergangenen sind definitiv versperrt. Dabei wird die Frage, wer wir denn waren, als Kind, als junger Mensch, uns trotzdem beschäftigen. Und diese Gedanken sind vielleicht stärker als die Suche nach der kommenden Zeit. Und doch lässt sich die monotone Autorität des Raben "Nevermore" unterlaufen.
Rückblicke sind Geschwister der Melancholie. In "Adorno wohnt hier nicht mehr" zeigt sich Jochen Schimmang als zarter Kenner dieser Suchbewegungen und Seelenlagen, und weil er darum weiß, kann er zudem auch witzig sein. So trägt das Buch der Erinnerungen und Imaginationen ein doppeltes Motto: "Mia san mia. - Bayrische Vereinsweisheit" und "Identität ist die Urform von Ideologie. - Adorno, Negative Dialektik".
In sieben autobiographisch geerdeten Erzählungen öffnet der erfahrene Autor Szenerien zwischen (vielleicht?) Mannheim - schachbrettartig angelegt, in gewisser Weise "die vollkommenste Stadt", weil "nicht klein und nicht riesengroß. Man verband mit ihr nicht irgendeine Bedeutung, das war das Freundliche an ihr" - und dem ebenfalls durch ein Schachbrett-Straßenmuster strukturierten Dorf Winchelsea im Südosten Englands, dazwischen Köln, Frankfurt, Berlin und die Norddeutsche Tiefebene, wo überall Menschen verschwinden oder dem Verschwundenen nachspüren oder am liebsten beides.
"Das Schönste an der Welt wird für mich mehr und mehr, dass man noch immer in ihr verschwinden kann, auch wenn es von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Das ist meine Art der Weltfrömmigkeit. Von allen Seinsweisen der Welt ist diejenige als Versteck für mich die Faszinierendste." So spricht der Philosophieprofessor der Eingangserzählung "Gutermuth und Rothermund"; er sammelt Geschichten von Verschollenen. In der "vollkommensten", weil unauffälligsten (also eigentlich abwesend anwesenden) Stadt wird er auf den Maler Rothermund treffen, der sich als Fälscher eines Künstlers entpuppt, den es nicht gegeben hat. Indem Rothermund Gemälde schafft, die dem Heimatkünstler Gutermuth zugeschrieben werden, erhält die blasse Stadt einen Helden, eine Berühmtheit, die ihr Image erhöht.
In der korrespondierenden Geschichte gegen Ende des Bandes wird Valerie Voss, von Beruf "Abwesenheitspflegerin" - sie kümmert sich um die Hinterlassenschaften von Verschollenen -, nach dem mittlerweile verschwundenen Fälscher Rothermund suchen. Sie entdeckt ihn in Rye (der Stadt bei ihrem Urlaubsdorf Winchelsea). Er sitzt malend am Kai. Und sie erfährt, dass er hier unter der Identität des Malers lebt, den er erfand. In der englischen Provinz war ihm ein Neuanfang als der deutsche Maler Robert Gutermuth gelungen. Er konnte in seiner Fiktion untertauchen. Eine Galerie und ein gewisser Erfolg seiner Landschaftsbilder ermöglichen ihm eine kleine Existenz. Gutes Dasein ist, sich entziehen zu können. Und so verwundert nicht, dass am Ende der Geschichte auch die Abwesenheitspflegerin Valerie Voss zuletzt im "Robert-Gutermuth-Museum" in der vollkommenen Stadt gesehen wurde "und seitdem unauffindbar" ist.
Schimmangs Erzählungen sind wirklichkeitshaltig, oft zeitlich eingrenzbar. Im Hintergrund kann der Brexit gewittern oder das Attentat auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo vom 7. Januar 2015. Doch glimmt immer wieder der poetische Funke des elegant Surrealen auf. In "Gott um halb sieben" begleitet der Leser die Büroangestellte Simone an einem trüben Dezemberabend ("warme Watteluft") durch die Kölner Vorweihnachtshektik. Clemens, mit dem sie sechs unvergleichliche Liebeswochen verbracht hat, ist spurlos und ohne eine Erklärung verschwunden. Fast beiläufig kauft sie sich eine neue Jacke, "ganz weich fallende warme Wolle, anthrazit, schön abgesetzter schwarzer Kragen aus Baumwollsamt, große Seitentaschen, in denen die Hände bequem verschwinden können". Und behält sie gleich an (nicht nur die Hände können in dem weichen, warmen Stoff verschwinden); sie betritt eine Kirche, in die sie - nicht gläubig, nur augenblicklichen Schutz suchend - manchmal geht. Und wird gleich umfangen von der kerzenflackernden Ruhe des sakralen Raums.
Gott ist ihr verlorengegangen, das letzte Mal hat sie als Teenager gebeichtet. Doch nun erkennt sie ihn in einem alten Mann im Fischgrätmantel. Er stellt sich, wie sie, vor den heiligen Antonius, den Schutzpatron derer, die etwas verloren haben, und zündet eine Kerze an. Simone nimmt ihre Plastiktasche wieder auf und nickt ihm zu. "Gott nickt leicht erstaunt zurück, und lächelnd verlässt sie sein Haus und reibt den Kragen der neuen Jacke einen Augenblick an ihrer linken Wange." Ein Mantel ist kein Ersatz für den Geliebten, ein Mann in Fischgrätmuster kein Messias. Und doch. Es liegt eine tröstende Alltagsfrömmigkeit in diesen zärtlich erzählten Geschichten.
Die titelgebende und längste Erzählung "Adorno wohnt hier nicht mehr" führt in die Anfänge von Jochen Schimmangs Schriftstellerlaufbahn, im Zeichen der K-Gruppen, der Adorno-Verehrung, des Frankfurter Suhrkamp-Verlags, der Frankfurter Verlagsanstalt. An der Seite seines im Literaturmarkt verschwundenen Freunds Wolfgang Utschick (1997 erschien dessen Roman "Die Veränderung der Sehnsucht" bei Suhrkamp, danach arbeitete er als Wachmann und im Theater als Logenschließer) beginnt er eine Frankfurter Spurensuche; und beide erinnern sich an die Zukunft.
Das erfundene Interview "Herr Rutschky oder Der Optimismus" führt in die kurze Euphorie des Münchner "TransAtlantik"-Magazins und die intellektuelle Gastfreundschaft des Ehepaars Katharina und Michael Rutschky, etwa wenn sie in der Früh "nacheinander in identischen blauen Morgenmänteln mit Waffelmuster aus ihren jeweiligen Zimmern kamen". So viel Anfang war nie.
Vielleicht ist der Literaturbetrieb nur erträglich, wenn man sich die Lizenz nimmt, in ihm ein wenig verschwinden zu dürfen. Wie auch eine Geburtstagsfeier zum Siebzigsten sehr lustig sein kann im Dachbodenversteck, wenn die Freunde ("Hebel, Hegel und Hesel"), die "Damen und Herren vom Förderkreis", die "Delegation des Ministeriums", die "Gruppe der Hauptstadtkollegen" und Barry Hulshoff, der in Amsterdam Figuratives Zeichnen unterrichtet, und Louisade de Bruyne, "die dasselbe in Brüssel tut", aus allen Himmelsrichtungen, im flachen Land von weither sichtbar, unaufhaltsam anrücken.
Dieses Buch ist voller Anspielungen und Schlüsselszenen einer untergegangenen geistigen und politischen Kultur. Seine Empathie liegt nicht bei den Siegern. Aber war es so nicht überhaupt?
ANGELIKA OVERATH
Jochen Schimmang:
"Adorno wohnt hier nicht mehr". Erzählungen.
Edition Nautilus, Hamburg 2019. 206 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main