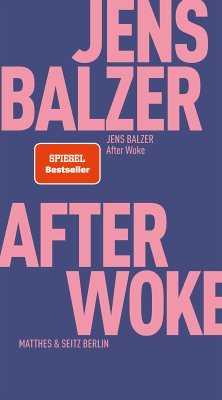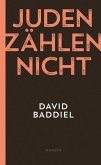Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Western
Manchmal ist es völlig ausreichend, wenn ein Film ganz einfach nur mit Genauigkeit und Passion die Erfordernisse eines Genres erfüllt, ohne Anspruch, sie aufzumischen oder zu verschieben. Weil er dann ganz bei sich bleibt. Es kann allerdings auch passieren, dass er dabei zu genügsam ist. Oder das, was ihm Originalität oder Eigensinn verliehe, nicht richtig ausspielt. Man sieht mit Sympathie zu - und hat am Ende den Eindruck, es fehle etwas. "The Dead Don't Hurt", die zweite Regiearbeit des Schauspielers Viggo Mortensen, ist ein solcher Film. Ein Western, der die Topoi, die Rollenmodelle, die Standardsituationen des Genres enthält. Der mit einer Schießerei im Saloon beginnt. Und das Porträt einer kleinen Stadt zeichnet, das man auswendig kennt: ein korrupter Bürgermeister, ein mächtiger Grundbesitzer, dessen brutaler, skrupelloser Sohn. Sie alle handeln, wie man es in der Konstellation erwartet. Mortensen selbst spielt den Zimmermann Olsen, der sich am Rande des Ortes in einer kargen Hütte niederlässt und auf Abstand hält. Er lebt zusammen mit der selbstbewussten, unerschrockenen Vivienne. Die wunderbare Vicky Krieps lässt sie durch ihr Spiel zum Herzen des Films werden. Als Olsen als Freiwilliger aufseiten der Union in den Bürgerkrieg zieht, rückt sie ins Zentrum, aber der Film unterläuft das immer wieder durch seine nicht chronologische Erzählweise. Er springt zwischen den Zeiten, ohne dass sich der Sinn dieser Bewegung erschlösse. Er erreicht damit, schon durch eine markante Sequenz zu Beginn, nur, dass der Film nicht primär zu Viviennes Geschichte werden kann, obwohl sie die komplexeste Figur ist. Der Showdown gehört den Männern. Das ist dann doch etwas zu wenig. pek
Bessern
Man kann, schreibt der Berliner Kulturjournalist Jens Balzer, "den Umgang der 'woken', postkolonialen, queerfeministischen Linken mit dem Terrorangriff der Hamas kaum anders bezeichnen denn als moralischen Bankrott", der "die Legitimität, mit der sie zuvor - in oftmals hohem moralischen Ton - rassistische, homophobe, misogyne Diskriminierungen kritisiert hat", infrage stelle. Aber, darauf läuft sein Essay "After Woke" (Matthes & Seitz, 12 Euro) hinaus: Kein Grund, deswegen mit postkolonialistischen Theorien und Praktiken an sich zu brechen. Oder sie für gescheitert zu erklären, wie das von rechts bis links geschehe. Vielmehr sei für dieses Lager der Moment zur Selbstkritik gekommen, auf fundamentaler Skepsis gegenüber eigenen Prägungen gründe die woke Weltsicht ja. Balzer spricht von einer "Infrastruktur" des Denkens. Über die Zeit habe sich aber ein "postkoloniales Wahrheitsregime" entwickelt, "in dem Menschen strikt 'along the color line' in Schwarz und Weiß eingeteilt" und "jüdische Menschen als privilegierte weiße Menschen betrachtet und damit auf die Seite der Unterdrücker oder Kolonialisten gestellt" würden. Eigentlich sei es bereits vor dem 7. Oktober höchste Zeit zur Kurskorrektur gewesen, antisemitische Auswüchse hätten sich schon in Bewegungen wie Black Lives Matter gezeigt. Balzer versucht, Identitätspolitik und Postkolonialismus mit deren eigenen Mitteln aus der Verirrung in den Essentialismus eines "indigenen" palästinensischen Volks und weißer israelischer Kolonialherren zurückzuholen, verbirgt sein Entsetzen über die Kälte und Ignoranz nicht, mit der Judith Butler und andere auf jüdische Terroropfer reagierten - aber gibt nicht auf: weder diese verirrten Linken noch die Hoffnung auf eine bessere Welt. tob
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.