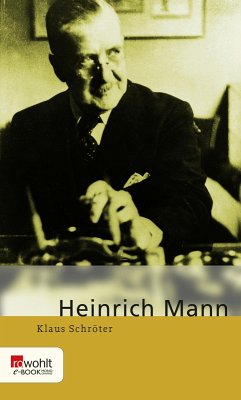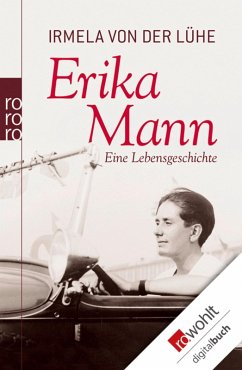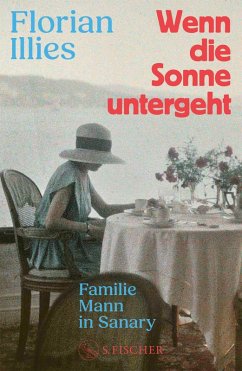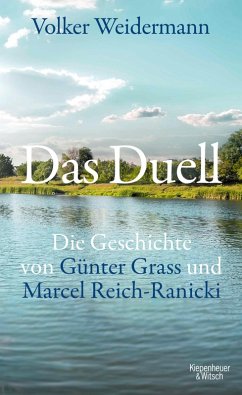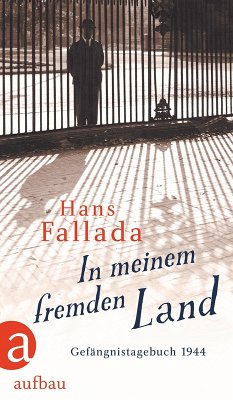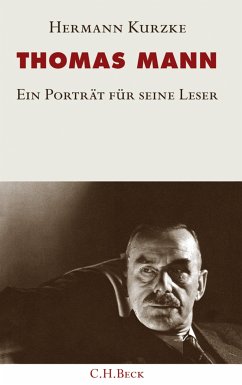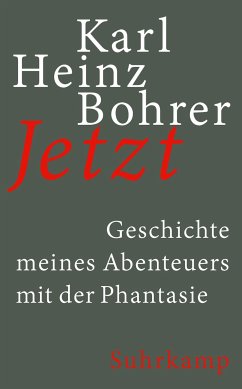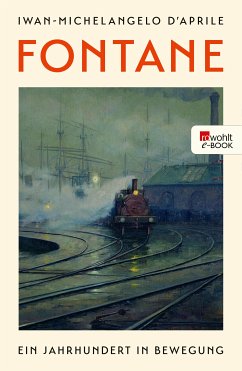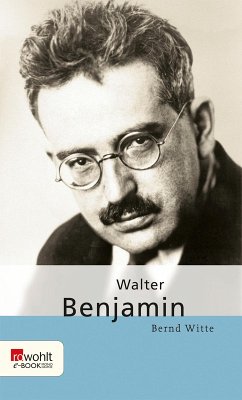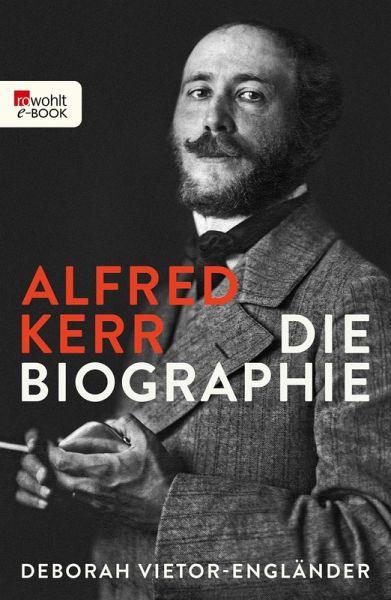
Alfred Kerr (eBook, ePUB)
Die Biographie
Sofort per Download lieferbar
Statt: 29,95 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Alfred Kerr ist uns in Erinnerung als der einflussreichste Theaterkritiker Deutschlands im 20. Jahrhundert. Er rühmte Henrik Ibsen als den Ahnherrn der Moderne, kämpfte für Gerhart Hauptmann, Arthur Schnitzler, Frank Wedekind, George Bernard Shaw, entdeckte Robert Musil, stritt gegen den Talmiruhm Hermann Sudermanns, kämpfte mit Bertolt Brecht, verspottete Karl Kraus und setzte gegen Thomas Manns endlose Sätze seine knappen, treffenden, die deutsche Sprache präzisierenden Sentenzen. Er war um 1910 verehrt von den jungen Dichtern, kämpfte in der Republik gegen Rückwärtserei und die Naz...
Alfred Kerr ist uns in Erinnerung als der einflussreichste Theaterkritiker Deutschlands im 20. Jahrhundert. Er rühmte Henrik Ibsen als den Ahnherrn der Moderne, kämpfte für Gerhart Hauptmann, Arthur Schnitzler, Frank Wedekind, George Bernard Shaw, entdeckte Robert Musil, stritt gegen den Talmiruhm Hermann Sudermanns, kämpfte mit Bertolt Brecht, verspottete Karl Kraus und setzte gegen Thomas Manns endlose Sätze seine knappen, treffenden, die deutsche Sprache präzisierenden Sentenzen. Er war um 1910 verehrt von den jungen Dichtern, kämpfte in der Republik gegen Rückwärtserei und die Nazis. Goebbels hasste ihn so sehr, dass Kerr sich 1933 ins Exil retten musste. Die Jahre in Paris und London waren ein Sturz in Not und Elend. Deborah Vietor Engländer erschließt in dieser Biographie zum ersten Mal das ganze, zum Teil unbekannte Leben und Wirken Alfred Kerrs, nutzt unbekannte Quellen und rückt uns diesen Streiter, der aus Lessings Geist lebte und mit dem Sprachwitz Heinrich Heines schrieb, wieder nah. Sie zeigt, welche Höhe dieser lebensdurstige Mensch erreichte und wie jäh sein Absturz war. Kerrs Biographie spiegelt exemplarisch das Leben jener jungen jüdischen Generation, die um 1880 aufbrach, um an der deutschen Kultur endlich teilzunehmen. Alfred Kerr starb 1948 in Hamburg, am Beginn einer Vortragsreise, als wollte ihn das Schicksal zurückführen in das Land, für dessen geistige Freiheit er stritt und das er nie vergaß. Seine von Günther Rühle in der Breslauer Zeitung der Jahrhundertwende entdeckten «Berliner Briefe» («Wo liegt Berlin?», erschienen 1997) führten zu Alfred Kerrs Neuentdeckung. Im Literarischen Quartett verkündete Marcel Reich-Ranicki damals: «Die Geschichte des deutschen Feuilletons muss nach diesem Buch neu geschrieben werden.» Die exemplarische Geschichte eines großen Schriftstellers, dessen glänzende Karriere die Nazis gewaltsam beendeten.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.