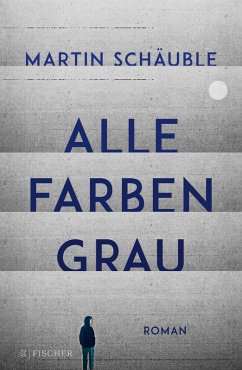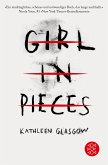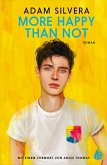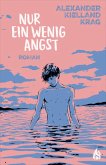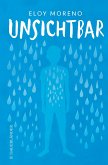Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Ein Jugendlicher begeht Suizid, eine Familie bleibt mit ihrer Trauer zurück. Martin Schäuble erzählt nach einer wahren Geschichte vom Tod und vom Leben.
Durchschnittliche Jugendliche gibt es nicht. Und doch stechen einige ganz besonders hervor. Der 16 Jahre alte Paul, Hauptfigur in "Alle Farben grau", dem neuen Roman von Martin Schäuble, ist so jemand. Er lernt Japanisch und spricht ein so gutes Englisch, dass ein kanadischer Mitschüler ihm während Pauls Auslandsjahr in Japan glaubt, er komme aus London. Woher er den Akzent hat? Von Monty Python. Denn wenn Paul sich für etwas begeistert, dann vollkommen. Neben den britischen Komikern liebt er "Per Anhalter durch die Galaxis" und Musik, vor allem aus den Siebzigern. Über Douglas Adams und David Bowie hält er detaillierte Vorträge, mit denen er seine Mitschüler regelmäßig zutextet. Dass er klüger ist als die meisten von ihnen, ist allen klar. Vermutlich ist er sogar klüger als seine Lehrer. "Der konnte alles, nur das Leben fiel ihm schwer", wird einer von ihnen bei Pauls Beerdigung sagen. Denn mit 16 Jahren begeht Paul Suizid.
Martin Schäuble wählt sich für seine Jugendbücher meist keine leichten Themen aus. Bekannt wurde er mit einem dystopischen Roman über eine Gesellschaft ohne gedruckte Bücher, spätere Romane spielen unter Reichsbürgern oder in einem von Rechtspopulisten regierten Land. Schäuble ist damit oft sehr nah an dem, was uns gegenwärtig beschäftigt.
Sein neuester Roman beruht auf einem wahren Fall und weist gleichzeitig über diesen hinaus. Denn Suizid, so heißt es im Roman, und so schreibt es Schäuble auch im Nachwort, ist kein großes Thema - "Es ist riesig". Unter Jugendlichen ist Suizid eine der häufigsten Todesursachen, rund ein Drittel in dieser Altersgruppe hat schon einmal darüber nachgedacht. Trotzdem ist er weiterhin tabuisiert, auch wenn sich in den letzten Jahren, unter anderem durch die Corona-Pandemie und einen Anstieg psychischer Erkrankungen unter Jugendlichen, einiges geändert hat.
Wie aktuell und gegenwartsbezogen "Alle Farben grau" ist, zeigt sich daran, dass sowohl die Pandemie als auch die damit einhergehenden Schulschließungen darin vorkommen. Für Pauls Entscheidung, sich umzubringen, sind sie nicht der entscheidende Faktor. Aber sie tragen dazu bei, dass er sich immer weiter von Sozialkontakten zurückzieht und sein Leben vom Tag in die Nacht verlegt. Kurz zuvor hat sich Pauls Verfassung während seines Auslandsjahres in Japan stark verschlechtert. Die Schule kontaktiert die Eltern, Paul kommt zurück nach Deutschland und in eine Klinik. Dort erhält er seine Diagnose: Asperger-Syndrom, kombiniert mit einer Depression.
Wir lagen total falsch
Die Familie trifft das unvorbereitet. So sagt die Mutter im Rückblick: "Sein Autismus fiel uns nicht auf. Er war für uns so, wie er war, wunderbar mit seinen charakterlichen Besonderheiten. Dass manche dieser Eigenschaften die Symptome einer psychischen Erkrankung hätten sein können, das war für uns damals unvorstellbar; darüber haben wir nie nachgedacht."
Genau das ist das Problem der Tabuisierung von psychischen Erkrankungen: Wird nicht darüber geredet, dann werden die Symptome nicht erkannt und werden die Betroffenen alleingelassen. Auch dieser Umstand wird in "Alle Farben grau" deutlich.
Der Roman, der zum Glück keine Spannung aufbaut, sondern von Anfang an voraussetzt, dass Paul nicht mehr lebt, erzählt die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Mal aus der Pauls, mal aus der seiner Freunde und Eltern, deren Erzählung teilweise klingt, als gäben sie die Vorfälle bei der Polizei zu Protokoll. Für den Roman ist das sinnvoll, nicht nur aus literarischer, sondern auch aus aufklärerischer Sicht. Weil wir verstehen, dass sich vom Verhalten einer Person nicht immer direkt auf ihr Innenleben schließen lässt, dass man sich täuschen kann. Ja, Paul ist speziell. Doch er ist auch so klug, nach seinem Klinikaufenthalt seinen eigentlichen Zustand vor seiner Familie zu verbergen. Während er vermittelt, es gehe ihm besser, plant er wohl schon seinen Suizid. "Er traf plötzlich wieder Freunde, saß sogar manchmal wieder mit uns zusammen in der Küche", berichtet sein Vater. "Wir interpretierten das positiv und lagen damit im Nachhinein total falsch. Er hat so Abschied genommen von uns allen, und wir haben das nicht gemerkt."
Gerade über Autisten gibt es eine Reihe von Klischees, die der Roman teilweise bestätigt - Paul ist so klug und nerdy, wie es Autisten für gewöhnlich nachgesagt wird -, vor denen er aber auch warnt. Noah, Pauls bester Freund, beschreibt es so: "Meine Freundin kennt Paul also nur von dem, was ich ihr erzähle. Sie kennt ihn auch nur mit der Diagnose, die er in der Klinik bekommen hat. Und dann läuft bei ihr der Film ab, also der Autistenfilm." Der "Autistenfilm", das ist wohl die Vorstellung einer Erkrankung, von der man eigentlich keine Ahnung hat.
An einer anderen Stelle kommt Mateo, ein Mitschüler Pauls, auf den "Club 27" zu sprechen, die Gruppe von Prominenten also, die im Alter von 27 Jahren gestorben sind, oft durch Suizid oder eine Überdosis. Paul wehrt sich gegen diese Erzählung, weil auch sie der Komplexität des Themas nicht gerecht wird, mehr ein Mythos als Realität ist: "Diese Rechnung geht ja nur auf, weil all die Promis, die sich früher oder viel später das Leben nehmen, dabei überhaupt nicht erwähnt werden." Ein Mann wie der Schauspieler Robin Williams, den Paul als Beispiel nennt und der sich mit 63 Jahren umbrachte, passt eben nicht in die Schublade eines tragischen, jungen Genies.
Die Stimme, der Pinguin
Indem Schäuble in "Alle Farben grau" unterschiedliche Sichtweisen auf Paul und seine Erkrankung einbettet, versucht er dieser Art von Vereinfachungen zu entgehen und zeichnet vielmehr ein komplexes Bild, das dabei nicht den Anspruch erhebt, exemplarisch für alle Menschen mit Autismus oder psychischen Erkrankungen zu sein. Die Jugendlichen, mit denen Paul seine Zeit in der Psychiatrie verbringt und mit denen er sich teilweise anfreundet, teilen mitunter Pauls Suizidgedanken, sind aber gleichzeitig sehr verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Symptomen. Gemein ist ihnen, dass die meisten einen gewissen Sinn für Humor nicht verloren haben, etwas, das sie verbindet und von anderen trennt, die nie wagen würden, morbide Witze zu reißen. Die Stimme, die Paul in seinem Kopf immer wieder niedermacht, ihm sagt, dass er nutzlos und minderwertig sei, nennt er "Pinguin". Wie den Antagonisten in Marc-Uwe Klings Känguru-Chroniken.
Etwas lässt "Alle Farben grau" mit guten Gründen aus: den Suizid selbst. Obwohl die Erzählung sich auf diesen Punkt hinbewegt, bleibt die Tat selbst die große Leerstelle des Romans. Wir erfahren weder etwas über ihre näheren Umstände, noch, welches Foto Paul seinen Freunden in Japan geschickt hat, um damit - erfolgreich - auf seine Suizidgedanken aufmerksam zu machen. So bietet das Buch weder eine Anleitung zum Nachahmen, noch bedient es voyeuristische Instinkte.
Auch der Zeit nach Pauls Tod widmet der Roman nur wenige Seiten. Natürlich geht es um die Folgen für Freunde und Familie, doch noch vielmehr geht es um die Frage, wie es überhaupt zu allem kam. So steht nicht Pauls Tod im Fokus. Sondern vor allem sein Leben. ANNA VOLLMER
Martin Schäuble: "Alle Farben Grau". Roman.
Verlag S. Fischer, Frankfurt 2023. 272 S., geb., 15,- Euro. Ab 14 J.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main