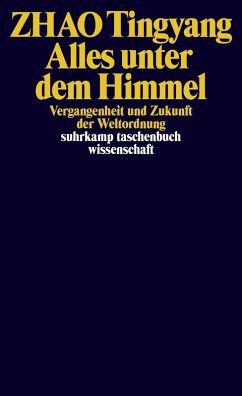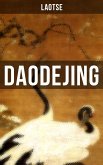Zhao Tingyang gilt als einer der bedeutendsten chinesischen Philosophen der Gegenwart. Mit diesem Hauptwerk liegen nun seine Überlegungen zu einer neuen politischen Weltordnung erstmals in deutscher Übersetzung vor. Sie basieren auf dem alten chinesischen Prinzip des tianxia - der Inklusion aller unter einem Himmel. In Auseinandersetzung mit okzidentalen Theorien des Staates und des Friedens von Hobbes über Kant bis Habermas sowie unter Rückgriff auf die Geschichtswissenschaft, die Ökonomie und die Spieltheorie eröffnet uns Zhao einen höchst originellen Blick auf die Konzeption der Universalität. Ein wegweisendes Buch, auch um Chinas aktuelles weltpolitisches Denken zu verstehen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Statt westlichen Werten: Zhao Tingyang springt vom Altertum zur zukünftigen Weltordnung
Zhao Tingyang, Jahrgang 1961, also nach der maoistischen Periode, die 1978 endete, intellektuell sozialisiert, ist Professor für Philosophie in Peking. Mit einem Zitat aus der "Washington Post" präsentiert ihn der Verlag auf der Rückseite dieses Buches als "einen der einflussreichsten zeitgenössischen Philosophen Chinas". Einflussreich auf wen? Auf die obersten Führungszirkel des Landes? Auf eine breitere intellektuelle Öffentlichkeit? Einflussreich in der kleinen kritischen Minderheit Chinas, der die offiziellen Medien und die großen Verlage verschlossen sind? Das ist nicht dasselbe. Einflussreich scheint er jedenfalls in Frankreich zu sein, wo ihn mehrere Übersetzungen bekanntgemacht haben.
Man soll ein Buch nach seinem Inhalt beurteilen. Dennoch schadet es nicht, einen Autor grob in seinem Wirkungsfeld zu plazieren. Zhao ist weder ein Parteiideologe und simples Sprachrohr des Regimes noch ein Dissident. Er gehört zu denjenigen, die man establishment intellectuals genannt hat. Das sind Wissenschaftler von hohem Status im akademischen System Chinas, Inhaber komfortabler Lehrstühle und nicht selten auch von Zweitprofessuren in den Vereinigten Staaten oder Australien, von der Zensur nicht betroffen oder so weit angepasst, dass sie keinen Anstoß erregen. Diese Etablierten sind durchaus nicht einer Meinung. Es gibt unter ihnen "Linke", die in China weiterhin Klassenunterschiede erkennen und eine gewisse Mao-Nostalgie pflegen, "Liberale", die auf Rechtsstaatlichkeit bestehen, auch wenn sie das Machtmonopol der Parteien nicht in Frage stellen, und "Konservative", die sich gerne auf den Konfuzianismus berufen, besonders seine hierarchisch-autoritären Aspekte. Was sie von der Kommunistischen Partei Chinas unter Xi Jinping halten, verraten sie alle wohlweislich nicht. Mit dem obersten Führer - und großen Teilen der Bevölkerung - träumen sie allerdings den "chinesischen Traum": das Land in jeder denkbaren Beziehung an die Weltspitze zu führen.
Zhao Tingyang, an der staatstragenden Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften tätig, sagt das nicht offen. Seine Philosophie der "Weltordnung", die mit sorgfältigen Begriffsdefinitionen zwar nicht widerspruchsfrei, aber doch transparent konstruiert ist, verfolgt kein nationalistisches Programm. Sie ist keine krude "China first"-Lehre. Ebenso wenig lässt sie sich auf eine Apologie neo-imperialer Expansion reduzieren. Das verbindet sie mit dem kanonischen Xi-Jinping-Denken: Dessen propagandistisches Axiom besagt, China sei weder ein normaler Nationalstaat noch ein Reich neuen Typs. Sein Aufstieg liege im Interesse der gesamten Welt. Es baue - etwa durch die Infrastrukturprojekte der Neuen Seidenstraße, seine Einflusspolitik in Afrika und die soft power der Konfuzius-Institute - kein machtgestütztes Imperium alten Stils auf, sondern verteile uneigennützig Wohltaten und übe eine gütige Hegemonie aus, unter der sich die Schwachen in Sicherheit entwickeln könnten.
Zhao argumentiert folgendermaßen: Die Welt steckt heute in einer multiplen Krise. Dorthin ist sie geraten durch die "internationale" Politik egoistisch miteinander konkurrierender Nationalstaaten, wie sie 1648 auf dem Westfälischen Friedenskongress erfunden wurden: ein toxisches Produkt Europas. Während der Dekolonisation haben sich die Völker in aller Welt dieses Modell des "souveränen", möglichst ethnisch homogenen Staates törichterweise aufschwatzen lassen. Im "globalen Imperialismus" der Vereinigten Staaten, der sich mit allen nur denkbaren Mitteln vom Finanzkapitalismus über die englische Sprache bis zur Menschenrechtspolitik die Erde Untertan zu machen versucht - Zhao schrieb sein Buch vor dem Beginn des trumpistischen Isolationismus -, hat diese destruktive Art von Machtpolitik Höhepunkt und Ende erreicht.
Demokratie erscheint als Irrweg.
Sie muss ersetzt werden durch eine wahre, post-imperialistische "Weltpolitik" im Geiste der Kooperation und des gegenseitigen Respekts. Nur so sind die großen Menschheitsfragen - Klimawandel, atomare Vernichtung, extreme Ungleichheit, .. . - lösbar. Diese Weltpolitik kennt keine tiefen Antagonismen mehr, wie Zhao sie auch als Obsession westlicher Theoretiker registriert: keinen Kampf aller gegen alle (Thomas Hobbes), keine Freund-Feind-Spaltung (Carl Schmitt), keine gewaltsam ausgetragenen Zivilisationskonflikte (Samuel P. Huntington). Da sie die ganze Menschheit in umfassenden Strukturen (über die Zhao konkret nichts sagt) zusammenfasst, ist die erstrebte Welt-Politik total und "inklusiv": Es gibt kein "Außen" mehr. Mit einem Wort, das Zhao Tingyang und sein versierter Übersetzer Michael Kahn-Ackermann nicht verwenden: Kriegerische internationale Politik soll sich in friedliche Weltinnenpolitik verwandeln.
So weit nichts Neues. Jede Friedensaktivistin und jeder Vertreter des "Idealismus" in der Theorie der internationalen Beziehungen würde all dies sofort unterschreiben. Man freut sich darüber, dass sich aus der Interpretation chinesischer Denktraditionen Schlüsse ergeben, die den Friedensutopien des Westens stark ähneln. Nur: Zhao hält nichts von Kosmopolitismus und universalen Menschenrechten. Er betrachtet die Vereinten Nationen als gescheitert und hält Demokratie, verstanden als prozedurale Ordnung, für einen illegitimen Irrweg, da sie der "Volksseele" nicht entspreche und den wahren "Volkswillen" nicht zum Ausdruck bringe. "Untauglich" sei auch die berühmte Versöhnung von Realismus und Idealismus in Immanuel Kants Vorschlag von 1795, durch graduelle Verrechtlichung eine keineswegs gutartige Menschennatur zum "ewigen", also relativ dauerhaften Frieden zu bewegen. Kant habe keine Lösung für das Zusammenleben unterschiedlicher Zivilisationen zu bieten.
Der schützende Hegemon.
Die chinesischen Vorstellungen von "tianxia" ("alles unter dem Himmel") und "datong" ("große Gemeinschaft"), die auf den ersten Blick dem westlich-aufklärerischen Konzept der geeinten "Menschheit" nahekommen, haben Zhao zufolge einen ganz anderen Ursprung. Es habe nämlich ein einziges Mal in der Geschichte solche idealen Tianxia-Verhältnisse bereits gegeben: im antiken China unter der Zhou-Dynastie (1046 bis 256 vor Christus). Diese Retro-Utopie einer perfekt harmonischen Ordnung, in der insbesondere die Interessen der zentralen Monarchie und die ihrer Vasallen ein Gleichgewicht fanden, hatte allerdings in der Wirklichkeit keinen dauerhaften Bestand. Zhao untersucht die Gründe ihres Scheiterns mit der nötigen historischen Konkretheit, hat dann aber erstaunlicherweise über die zwei Jahrtausende (221 vor Christus bis 1949), in denen sich in China imperiale Zentralisierung und Reichszerfall phasenweise abwechselten, nichts Originelles zu sagen.
Warum also diese schwärmerische Darstellung des chinesischen Altertums, die in der Tonlage an die Polis-Begeisterung der verschiedenen europäischen Humanismen und Neohumanismen erinnert, wenn Zhao Tingyang gar keine Neuauflage des antiken Tianxia-Systems empfiehlt und für möglich hält? Das bleibt unklar. Die Antwort findet sich in anderen Texten von Zhao und überhaupt in dem weitverzweigten neuen Tianxia-Diskurs, der in China seit etwa der Jahrtausendwende geführt wird und in dem Zhao eine Stimme unter mehreren ist.
"Tianxia" muss als ein bewusst nebulös gehaltener Begriff verstanden werden, für manche chinesische Autoren ein Gegenentwurf zu übertrieben exakter "westlicher" Kategorienbildung. "Tianxia" ist weniger eine strukturierte, in Institutionen greifbare Ordnung als ein Lebensgefühl hierarchischer Geborgenheit, eher eine Wellness-Semantik als eine Kategorie der politischen Herrschaftslehre. Was Zhao Tingyang utilitaristisch als "eine für alle Beteiligten befriedigende Nutzensteigerung" definiert, pflegt der oberste Machthaber Chinas eine "Win-win-Situation" zu nennen. Win-win-Erfolge sind unter Bedingungen realer Supermacht-Rivalität kaum zu erreichen; der Kalte Krieg vor 1989/90 zeigt dies ebenso wie der "Handelskrieg" zwischen den Vereinigten Staaten und China. Win-win floriert der Tianxia-Theorie zufolge am besten in hierarchischen Verhältnissen wie zum Beispiel den "Tribut"-Beziehungen des kaiserlichen Chinas mit zahlreichen seiner Nachbarn: Im Austausch für reale und symbolische Unterwerfung des Schwächeren bietet die hegemoniale Zentralmacht Schutz, Sicherheit und kulturelle Ressourcen.
Zhao Tingyang sagt an keiner Stelle, dass die angestrebte neue Weltordnung, die sowohl den Imperialismus als auch den Pseudo-Egalitarismus von 193 gleichermaßen "souveränen" UN-Mitgliedstaaten (auch San Marino mit 33 000 Einwohnern gehört dazu) hinter sich lässt, eine von China dominierte Weltordnung sein soll und wird. Er reiht sich nicht ein in den Chor der Propheten eines Chinese Century. Aber wer ist würdig, an die Spitze der Tianxia-Hierarchie zu treten? Die Vereinigten Staaten sind in Zhaos Augen moralisch diskreditiert und machtpolitisch im Niedergang begriffen. Die Europäer haben früher einmal als Kolonialmächte Schrecken verbreitet, spielen aber heute auf der Weltbühne nur noch Nebenrollen. Russland wird mit keinem Wort erwähnt. Indien und Japan haben niemals universale Ansprüche angemeldet. Wer also bleibt als Kandidat für den Primat auf dem Planeten?
JÜRGEN OSTERHAMMEL.
Zhao Tingyang: "Alles unter dem Himmel". Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung.
Aus dem Chinesischen von Michael Kahn-Ackermann. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 266 S., br., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Das Buch ist eine gute Grundlage für jene, die Analysemuster, die Gestaltungsstrukturen und die mächtigen Durchsetzungskräfte Chinas verstehen wollen.« Holger Friedrich Berliner Zeitung 20231216