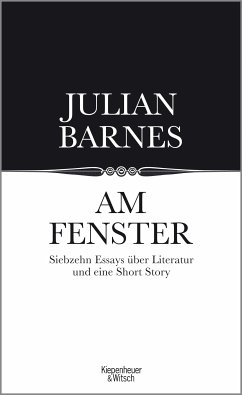Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Ein seelenvoller Genauigkeitsfanatiker: Julian Barnes beschert uns zu seinem siebzigsten Geburtstag Essays zur Literatur und fordert Hemingway zum Duell.
Je länger Julian Barnes schreibt, desto kürzer, konzentrierter und klarer werden seine Bücher. Zwar war auch der gelehrte Verfasser von vergnüglichen Vexierspielen wie "Flauberts Papagei" (1984) oder "Eine Geschichte der Welt in 10 1/2 Kapiteln" (1989) bereits ein Könner der Reduktion, der in scheinbar entlegenen Details seine Hauptsachen spiegelte, doch die Intensität der Emotion, die aus den Werken der letzten Dekade spricht, war hinter den geschliffenen Prosafassaden damals bestenfalls zu erahnen. Rückblickend lässt sich am ehesten der 2007 erschienene Roman "Arthur & George" als werkhistorischer Wendepunkt ausmachen, der mehr als vom Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle von den Ängsten und Heimsuchungen des indischstämmigen Birminghamer Anwalts George Mason handelt. Barnes' Bücher haben zuletzt eine Beseelung erfahren, und sie zeigt sich nicht nur in den fiktionalen Texten dieses Autors, der längst den Ruf eines modernen Klassikers genießt.
In seinem eigentlichen Element ist Julian Barnes im Grunde weniger im Roman als in Erzählungen, Kurzgeschichten und Essays. Die Pflicht zu Kürze und Prägnanz kommt ihm entgegen. Und obwohl er genüsslich satirisch schreiben kann, ist sein großes Thema eines geworden, das Witz nur als Galgenhumor und diesen nur in kleiner Dosierung verträgt.
Der Tod, die ständige Angst davor und die zwiespältige Gunst einstweiligen Weiterlebens, während andere sterben, sind in Julian Barnes' Werk überwältigend präsent. Vom autobiographischen "Nichts, was man fürchten müsste" (2008) über die Novelle "Vom Ende einer Geschichte" (2011) bis hin zum schmalen Band "Lebensstufen", mit dem er den Verlust seiner Frau, der Literaturagentin Pat Kavanagh, betrauerte, lassen sich seine Bücher als Versuch lesen, dem Sinnlosen einen Sinn abzugewinnen.
Zu seinem siebzigsten Geburtstag, den Barnes am kommenden Dienstag feiert, hat er zunächst nur seinen englischen Lesern einen neuen Roman geschenkt. "The Noise of Time" handelt von einem Mann, der im Jahr 1937 in seinem Wohnblock in Leningrad vor dem Aufzug steht, zu seinen Füßen ein Köfferchen mit Zigaretten, Unterwäsche und Zahnpulver. Es ist Dmitri Schostakowitsch, der auf seine Verhaftung wartet, nachdem Stalins Besuch seiner gefeierten Oper "Lady Macbeth von Mzensk" zum Fiasko geriet. Wie gewohnt lässt sich Barnes von den Tatsachen leiten, doch wie er seinen Helden zum Leben erweckt und mit ihm die Frage, in welchem Wahrheitsverhältnis Kunst und Politik zueinander stehen können, das bezeugt die souveräne Meisterschaft dieses zurückhaltenden, wenngleich keineswegs an falscher Bescheidenheit krankenden Erzählers. Julian Barnes weiß, was er kann - und auch, dass dies keine Kleinigkeit ist. Das bestätigt ein Buch, das soeben bei uns zu Barnes' rundem Geburtstag erschienen ist und das den Autor in Hochform zeigt.
"Am Fenster", im englischen Original bereits 2012 erschienen, enthält Essays zur Literatur und die dreiteilige, herrlich vergiftete Kurzgeschichte "Hommage an Hemingway", in welcher der amerikanische Klassiker unter anderem mit einem "mit Steroiden vollgepumpten Sportler" verglichen wird. Faszinierend ist "Am Fenster" aber vor allem der Essays wegen, in denen Julian Barnes sich ebenso mit großen britischen Autoren - ganze drei Texte beschäftigen sich mit dem seltsamen Fall des so berühmten wie unbeliebten Ford Madox Ford, zwei mit Rudyard Kipling, der fast so frankophil war wie Barnes selbst - wie mit Schriftstellern der zweiten Reihe auseinandersetzt. Die Fallstricke des Ruhms, wie sich Umstände, Zufälle oder Charaktereigenschaften in Biographien schieben, die sonst einen ganz anderen Verlauf hätten nehmen können, interessieren Barnes besonders.
Lehrreich ist auch der Aufsatz über das Übersetzen von "Madame Bovary", in dem Barnes unter anderem der Frage nachgeht, ob Schriftsteller aufgrund ihres Sprachgefühls eigentlich die besseren Übersetzer sind (nein) und warum der Gedanke an die Qualen der Übersetzer beim Schreiben nur in Ausnahmen zu jener Art von Fair-Trade-Literatur führt, von welcher der Leser ebenso profitiert wie der Autor: "Abgesehen davon, dass man damit die eigene Sprache verleugnet, kann das auch leicht zu einer internationalen Schreibweise führen, die den Mahlzeiten im Flugzeug gleicht: macht alle satt, ist nicht direkt giftig, hat aber keinen erkennbaren Nährwert."
Solche entschiedenen Meinungen und Urteile dosiert Barnes indes fein, wie er den Pedanten, der er durchaus auch sein kann (wie in "Fein gehackt und grob gewürfelt", 2003), überhaupt zügelt; der Hauptantrieb seiner Beschäftigung mit anderen Autoren ist erkennbar eher Bewunderung und Neugier denn Konkurrenz. Das macht den Auftakt über die vermeintliche Harmlosigkeit der großartigen, hierzulande leider kaum bekannten Penelope Fitzgerald zu einem mitreißenden Plädoyer - wie das Buch ohnehin insofern eine teure Anschaffung ist, als dass Barnes den Leser zu Autoren und Werken verführt, die vorher sicher nicht auf seiner "To read"-Liste standen.
Aber natürlich erfährt man aus den Details, die Barnes herausgreift, und den Kunstgriffen, die er preist, auch viel über ihn selbst. Wenn er etwa Penelope Fitzgerald dafür bewundert, dass sie "Fakten und Einzelheiten so einsetzt, dass dabei mehr herauskommt als die Summe ihrer Teile", ist damit auch ein eigenes Ziel benannt. Aber auch ex negativo verrät er viel von sich, etwa wenn er George Orwell in einem temperamentvollen Abgesang als "Ein-Mann-Rüpelriege" abkanzelt, "die unverblümt die Wahrheit sagt, und das ist, wie die Engländer sich gern einreden, das Englischste überhaupt".
Der interessanteste Essay aber ist einer, in dem Barnes sich weder für noch gegen seinen Gegenstand so recht entscheiden kann - und ausgerechnet diesem Stück merkt man an, dass es nicht ganz frisch ist. Es handelt von Michel Houellebecq und dessen Romanen "Elementarteilchen" und "Plattform". Hier wüsste man gern, wie Barnes den Autor nach seinem neusten Werk "Unterwerfung" beurteilt. Aber den Leser neugierig und hungrig nach mehr zurückzulassen ist für einen Essayband keine kleine Leistung.
FELICITAS VON LOVENBERG.
Julian Barnes: "Am Fenster". Siebzehn Essays über Literatur und eine Short Story.
Aus dem Englischen von Gertraude Krueger, Thomas Bodmer, Alexander Brock und Peter Kleinhempel. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2016. 350 S., geb., 21,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main