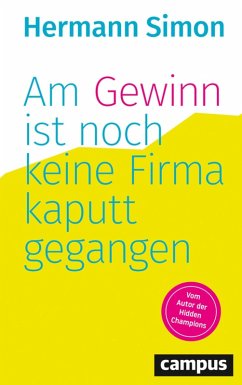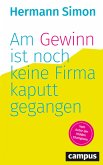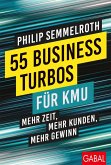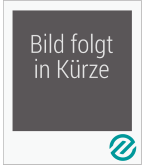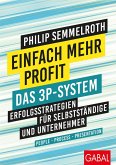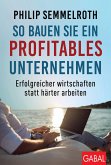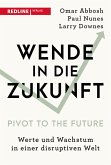Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Hermann Simon verteidigt eine umstrittene Größe
Im ersten Satz des Buches bekennt Hermann Simon: "Ich bin für Gewinnmaximierung!" In den letzten zwei Sätzen bekennt er: "Mein Fazit lautet deshalb, dass es für private Unternehmen keine Alternative zur Gewinnorientierung gibt. Denn am Gewinn ist noch keine Firma kaputtgegangen." Dazwischen beleuchtet er auf 260 Seiten das Thema Gewinn. Der Gewinn ist eine zentrale volks- wie betriebswirtschaftliche Größe. Der Gewinn ist der bekannteste Erfolgsmaßstab - und sehr umstritten, zumindest in der Zuspitzung der Gewinnmaximierung. Gewinn wird von den einen als Risikoprämie gepriesen, von anderen neutral als Restgröße aus Ertrag abzüglich Aufwand beschrieben, aber von Gegnern auch als unanständiger Profit verteufelt. Die aktuelle Diskussion um Shareholdervalue einerseits und Stakeholdervalue andererseits ist auch eine Diskussion darüber, wie viel Gewinn angemessen ist.
Diese wenigen Aussagen deuten schon den Facettenreichtum des Themas an. Es erstaunt daher, dass die Wissenschaft den Gewinn eher am Rande behandelt. Sie vermittelt die Gewinnberechnung, also die Gewinn- und Verlustrechnung, und beschreibt die Gewinnverwendungspolitik (Einbehaltung oder Ausschüttung). Simon ist aber der erste Autor, der dem Thema ein ganzes Buch widmet und vor allem jene Aspekte hervorhebt, die in klassischen BWL-Büchern nur kurze Erwähnung finden. Ihm geht es darum, in der gesellschaftlichen Diskussion um den Gewinn Stellung zu beziehen und Argumente zu liefern. Damit ist er aktueller als gedacht. Wer jetzt in der Corona-Krise nicht Rücklagen aus vergangenen Gewinnen hat, der bricht ganz schnell zusammen und hält nicht einmal wenige Wochen Umsatzausfall durch.
Simon kann der auf Peter Drucker zurückgehenden Definition viel abgewinnen, wonach Gewinn als ein Teil der vom Preis zu deckenden Kosten anzusehen ist. Auf jeden Fall ist Gewinn für ihn die einzige sinnvolle Zielgröße für ein Unternehmen. Denn im Gewinn finden alle Konsequenzen unternehmerischen Handelns ihren quantitativen Ausdruck. Daher sollte die absolute Gewinnhöhe das entscheidende Ziel sein, der sogenannte "echte Gewinn", wie er den Nettogewinn (Jahresüberschuss) nach Abzug aller Kosten nennt.
Mit großer Berechtigung wendet er sich gegen die modischen verwässerten Gewinngrößen, von denen Manager gern schwadronieren. Das reicht vom "Gewinn vor Steuern" bis hin zu "Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen" oder gar zu "bereinigtem Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen". Im letzten Fall bleiben auch noch Einmalaufwendungen oder Restrukturierungskosten unberücksichtigt. Je weniger Kosten berücksichtigt werden oder dem Nettogewinn wieder hinzugerechnet werden, um so aussageloser wird die Kennzahl. Ein Unternehmen, das seine Abschreibungen nicht verdient, vernichtet jeden Tag Vermögen.
Simon strebt nicht nur Nettogewinn an, er bekennt sich ganz klar zur Maximierung des Gewinns als Unternehmensziel. Erstens sei das Gewinnziel als solches und die Maximierung des Gewinns im Besonderen der Hauptgrund dafür, dass die Marktwirtschaft effizienter sei als andere Wirtschaftsordnungen. "Gewinnmaximierung ist aber auch Minimierung der Verschwendung und insofern vom Ansatz her Ressourcen schonend, nicht Ressourcen verschwendend und führt damit gleichzeitig zur optimalen Wohlstandsleistung." Dass gerade deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich niedrige Gewinne erwirtschaften - im Durchschnitt nur 4 Prozent vom Umsatz, liegt nach Simons Ansicht vor allem an drei Ursachen; in erster Linie an der Verfolgung falscher Ziele, aber auch an Überkapazitäten in einigen Branchen und an einer zu hohen Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten oder Kunden. Das sind seiner Meinung nach die drei größten Gewinnkiller.
Vor allem das beliebte Ziel hoher Marktanteile verurteilt er. Es gebe bis heute keinen Beweis dafür, dass ein hoher Marktanteil einen Einfluss auf die Höhe des Gewinns habe. Ein weiterer Grund für die niedrigen Gewinne sieht er in der gesellschaftlichen Verteufelung des Gewinns als Profit, wobei die meisten Kritiker die tatsächliche Höhe des Gewinns weit überschätzen, also gegen Windmühlen kämpfen. Viele Unternehmen verdienen nicht einmal ihre Kapitalkosten, jedenfalls die für das Eigenkapital. Dieser Vorwurf ist aber schwer objektivierbar, weil der Renditeanspruch eines Eigenkapitalgebers unterschiedlich hoch sein mag in Abhängigkeit von anderen Zielen. Dass Unternehmer bei einem Unterschreiten einer bestimmten Eigenkapitalverzinsung ihr Geld aus dem Unternehmen ziehen, lässt sich in der Praxis kaum beobachten. Unternehmer verfolgen meist andere Ziele wie jene, ihren Kindern ein gesundes Unternehmen übergeben zu können, in der Region eine bedeutende Rolle zu spielen, den Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze zu geben oder ein bestimmtes Produkt produzieren zu wollen. Es gehen daher auch viel weniger Unternehmen in die Insolvenz als Simon in seinem Vorwort glaubt.
Auf sicherem Terrain befindet sich der Autor dann wieder, wenn er über das Zusammenspiel von Gewinn, Preis und Kosten berichtet. Simon wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Preisveränderungen sofort auf den Gewinn durchschlagen, während Kostenveränderungen dies erst mit einer Zeitverzögerung tun.
Der Unternehmer, Berater und Theoretiker Simon möchte über den Gewinn diskutieren, ihm den Rücken stärken und seine Gegner überzeugen. Dazu gibt das Buch viele und gute Anregungen.
GEORG GIERSBERG
Hermann Simon: Am Gewinn ist noch keine Firma kaputtgegangen. 260 Seiten, Campus Verlag, Frankfurt 2020, 34 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main