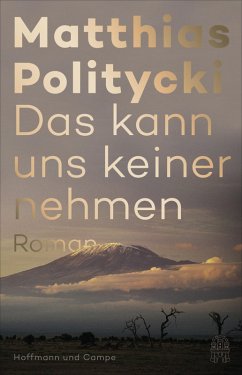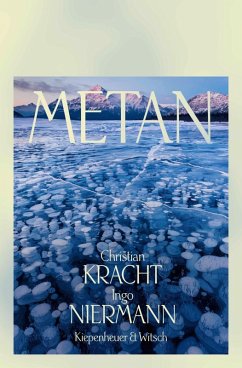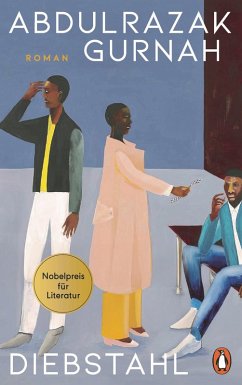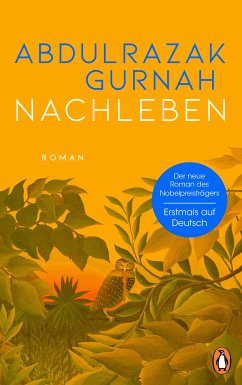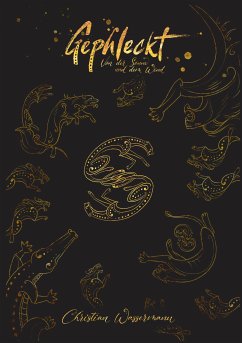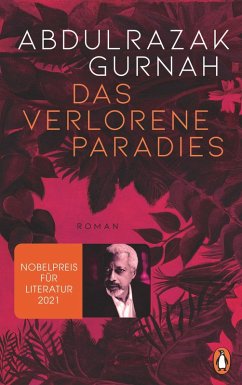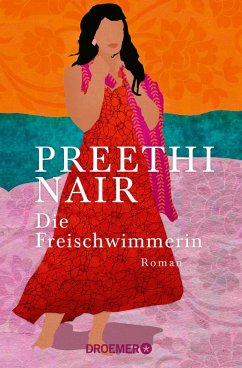Am siebten Tag flog ich zurück (eBook, ePUB)
Meine Reise zum Kilimandscharo
Sofort per Download lieferbar
Statt: 23,00 €**
19,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Zum Kilimandscharo reist in diesem wundersamen Buch der Ich-Erzähler, hinter dem sein Autor Arnold Stadler gut zu erkennen ist. Eine Reportage soll er schreiben, aber er will weder auf den Gipfel noch auf Safari gehen. Im Gegenteil: Er hat Angst vor wilden Tieren und einen Smoking und Lackschuhe im Gepäck, weil er ja anschließend eine Einladung nach Bremen hat ... Und es genügt ihm völlig, einfach den wunderbaren Berg anzuschauen, der als Ölgemälde in der elterlichen Wohnstube hing und seither sein Sehnsuchtsziel ist. Die Reise nach Afrika wird für den Erzähler zu einer tragikomischen...
Zum Kilimandscharo reist in diesem wundersamen Buch der Ich-Erzähler, hinter dem sein Autor Arnold Stadler gut zu erkennen ist. Eine Reportage soll er schreiben, aber er will weder auf den Gipfel noch auf Safari gehen. Im Gegenteil: Er hat Angst vor wilden Tieren und einen Smoking und Lackschuhe im Gepäck, weil er ja anschließend eine Einladung nach Bremen hat ... Und es genügt ihm völlig, einfach den wunderbaren Berg anzuschauen, der als Ölgemälde in der elterlichen Wohnstube hing und seither sein Sehnsuchtsziel ist. Die Reise nach Afrika wird für den Erzähler zu einer tragikomischen Tour de Force durch deutsche Gegenwart, koloniale Vergangenheit und touristische Träume. Und, wie könnte es anders sein bei diesem Autor, zu einer kurvenreichen Erkundung des eigenen Inneren und des ganzen menschlichen Lebens. »Am siebten Tag flog ich zurück« ist ein poetisches Plädoyer, in einer sich wandelnden Welt das eigene Ich zu erhalten, die eigenen Wege zu gehen - und auf dem Glück zu bestehen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.