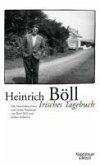Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Fünfzig Jahre nach seiner Amerika-Reise hat Siegfried Lenz das damals geführte Tagebuch veröffentlicht - das einzige, das er je schrieb
Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, im Herbst 1962, wird der Schriftsteller Siegfried Lenz vom amerikanischen Botschafter in der Bundesrepublik zu einer großen Reise in die Vereinigten Staaten eingeladen. Junge und für die öffentliche Meinung wichtige Intellektuelle sollen für den amerikanischen Weg gewonnen werden, und so stehen dem sechsunddreißigjährigen Lenz, wohin er auch kommt, die Türen weit offen. Neugierig und unternehmungslustig und manchmal am Rande der Überforderung durch eine gutgemeinte Rundumbetreuung, führt er während der fünfwöchigen Reise das einzige Tagebuch seines Lebens. Genau fünfzig Jahre später hat er es jetzt, mit einem kurzen Vorwort, veröffentlicht. Es ist ein überraschendes Zeitdokument, ein Lesevergnügen - und ein Hörvergnügen obendrein, denn Burghart Klaußner hat den Text gleichzeitig vollständig als Hörbuch eingelesen, in jenem halb sachlichen, halb staunenden Ton, in dem man sich diese Reisenotizen denkt.
Aufmerksam verfolgt Lenz die politische Zuspitzung, von Kennedys Fernsehansprache bis zur Militarisierung des Landes ("Florida gleicht einem Heerlager"). Zugleich aber entdeckt er ein Land, das für die Deutschen noch immer vom Mythos des Fernen und Fremden umgeben ist. Er entdeckt es auf einer Reise, um die man ihn noch heute beneiden könnte: kreuz und quer durchs Land, von New York durch Virginia, den Mittleren Westen nach Wyoming und Texas, nach San Francisco und New Orleans. Da man ihm alles zeigen will, nimmt er alles auf, ganz Auge und Ohr für das neue Land. Das Sensationelle - die Zugfahrt durch die Rocky Mountains, das spektakuläre Branding der Kühe auf einer texanischen Farm - vermerkt er so genau wie das Beiläufige, Wörter wie "Drive-in-Bank" zum Beispiel oder "Motel". Auch dass ein "Einkaufszentrum" hier supermarket heißt, verdient eine Notiz. Oft wechseln Vogelschau und Nahsicht buchstäblich: Aus dem Flugzeug lassen sich die Transformationen von Landschaften erkennen, in denen der "Akt der Erschließung noch sichtbar" ist. Im Treppenaufgang seines Hotels in Wyoming wenig später fällt der Blick auf einen "Gewehrständer mit verschiedenen Büchsen, alle geladen". Dieser Reisende interessiert sich für Klatsch über Joe DiMaggio ebenso wie für das Bankwesen und das amerikanische Bildungssystem ("hier wurde Selbstgewissheit, Selbstsicherheit trainiert") und für die Mode ("weltläufiges Makeup, entsetzliche Hüte"). Und für die Literatur sowieso. Lenz begegnet Germanisten wie Bernhard Blume und Herbert Lehnert, Dichtern wie dem jungen John Ransom und dem greisen Robert Frost, und in Kalifornien erlebt er die "Beatniks, Priester des Jazz".
Inmitten einer politischen Krise, die an den Rand eines Weltkrieges führt, wird so die erstaunlich tiefenscharfe Momentaufnahme eines Landes sichtbar, das keineswegs nur in der Wahrnehmung des jungen Deutschen von 1962, sondern auch aus der Rückschau eines halben Jahrhunderts sehr weit entfernt erscheint. Das Amerika, das Lenz bereist, lebt in einem ökonomischen Überfluss, der nie enden zu wollen scheint. Das gravierendste Problem der Landwirtschaft ist die kaum zu bremsende Überproduktion; überhaupt scheint das Land "so reich zu sein, dass es alles (vor allem Essen) wegwirft, was nicht mehr brandneu ist". Zugleich aber werden überall Aufbrüche sichtbar, die Lenz mit dem Scharfblick des Schriftstellers notiert. In New Orleans bemerkt er, dass in der Straßenbahn neuerdings die Trennwände zwischen Sitzen für Schwarze und Weiße verschwinden, "das wäre vor zwei Jahren undenkbar gewesen"; in San Francisco überrascht ihn das Verschwinden der Segregation: "Ich sah Schwarze mit weißen Mädchen, einen Chinesen mit einer Indianerin." In den Universitäten fällt ihm die noch immer große Kenntnis der Exilanten Thomas Mann und Brecht auf - und die wachsende Politisierung der Studenten, die von der Literatur vor allem "Engagement, Entscheidungen, Proteste, Stellungnahmen" erwarten.
Gerade indem dieses Tagebuch sich aufs genaue Hinsehen beschränkt, gewinnt es literarisches Format; ein Reisebericht voller Temperament und Tempo. Lakonische Schnappschüsse - "Schilder, die vor verbotener Jagd warnen, sind von Kugeln der Enttäuschung zerfetzt" - stehen neben knappen und plastischen Charakterisierungen von Menschen, die man sich gern als Romanfiguren vorstellen möchte. Da richten sich "kalte listige Greisenaugen, sehr wach", auf eine kluge, "ein wenig müde lässige Herrendame". Lenz reist als Zeitzeuge und als Schriftsteller, voller Sympathie für das Land und bemerkenswert frei von Ressentiments wie von Verklärung. Beinahe wird er auf diese Weise selber zum Landsmann; "Bob und Debby nannten mich Sig".
Als man ihn einmal zu seiner Ansicht über die Amerikaner ausfragen will, seufzt Sig: "Mein Gott, was nützen persönliche Konfessionen." Dieser Verzicht kommt seinen Aufzeichnungen zugute. Weil sie auf Konfessionen verzichten und lieber, wie jetzt das Vorwort resümiert, "einfach festhalten, was der Tag brachte", sind sie offen für das Unvertraute. Und gerade darum wirken sie so glaubhaft und persönlich. In einer der vielen Literaturdebatten, in die er hineingezogen wird, beharrt Lenz 1962 auf der "Überzeugung, dass Schreiben vor allem verstehen heißt, oder doch verstehen lernen". Das ist ein schöner Nebeneffekt dieses Buches: dass es auf der Reise durch ein fremdes und faszinierendes Amerika zeigt, wie man verstehen lernt.
HEINRICH DETERING
Siegfried Lenz: "Amerikanisches Tagebuch 1962".
Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2012. 150 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main