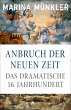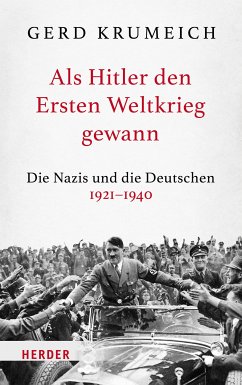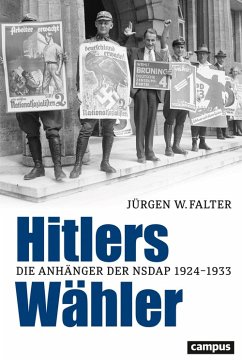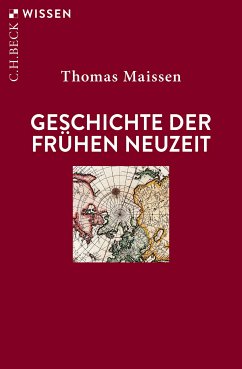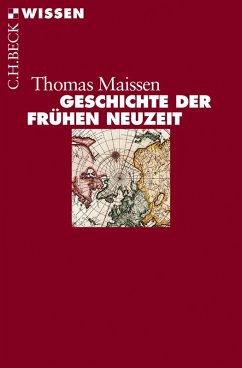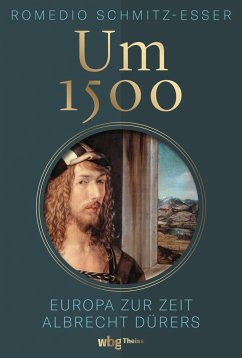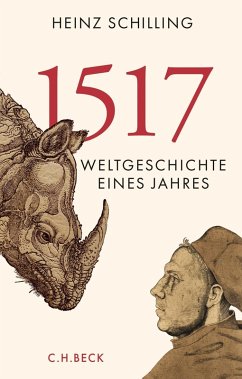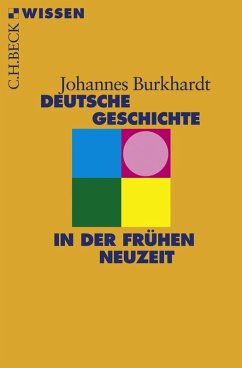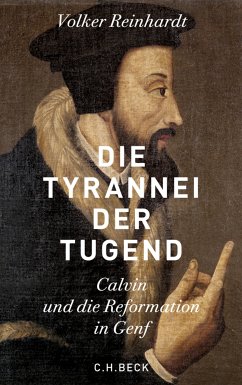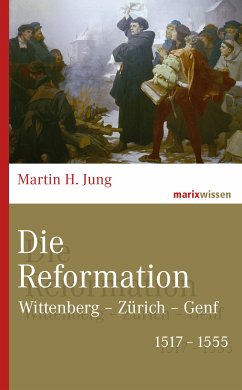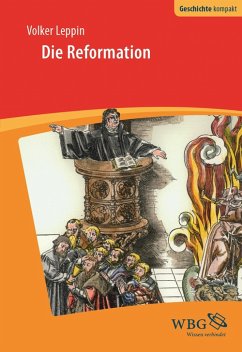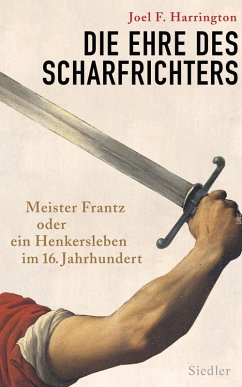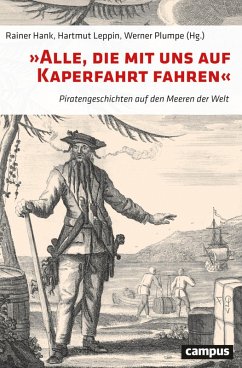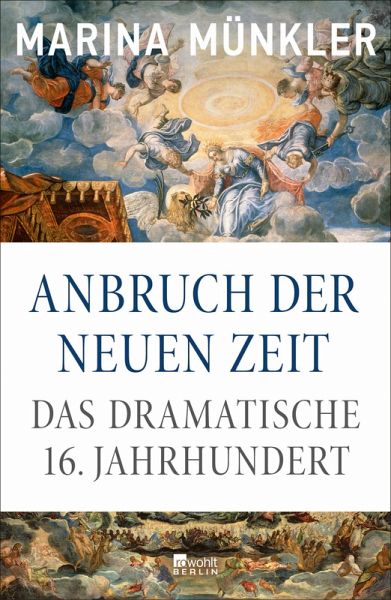
Anbruch der neuen Zeit (eBook, ePUB)
Das dramatische 16. Jahrhundert Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste von Die Zeit, Deutschlandfunk und ZDF
Sofort per Download lieferbar
Statt: 34,00 €**
29,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste von Die Zeit, Deutschlandfunk und ZDF: «Marina Münkler entwirft das Panorama einer revolutionären Epoche. Lehrreich und mitreißend zugleich.» Im 16. Jahrhundert ändert sich die Welt von Grund auf. Als Christoph Kolumbus 1492 einen bis dahin unbekannten Erdteil entdeckt, entsteht zugleich der Anspruch einer europäischen Herrschaft über diese «neue» Welt; das Christentum wird zu einer globalen Religion. Gleichzeitig steht die Alte Welt unter dem enormen Druck der tief nach Europa expandierenden Osmanen, und wenig später zerfällt mit dem Thesenanschlag...
Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste von Die Zeit, Deutschlandfunk und ZDF: «Marina Münkler entwirft das Panorama einer revolutionären Epoche. Lehrreich und mitreißend zugleich.» Im 16. Jahrhundert ändert sich die Welt von Grund auf. Als Christoph Kolumbus 1492 einen bis dahin unbekannten Erdteil entdeckt, entsteht zugleich der Anspruch einer europäischen Herrschaft über diese «neue» Welt; das Christentum wird zu einer globalen Religion. Gleichzeitig steht die Alte Welt unter dem enormen Druck der tief nach Europa expandierenden Osmanen, und wenig später zerfällt mit dem Thesenanschlag Martin Luthers ihre religiöse Einheit. Marina Münkler durchmisst dieses dramatische Zeitalter der Entdeckungen und Konflikte, erzählt von den «Wilden» der Neuen Welt und den «Heiligen» der Alten ebenso wie von den Auseinandersetzungen um die «Türken». Münkler schildert die Medienrevolution des Buchdrucks und die Reformation, die das Verhältnis jedes Einzelnen nicht nur zur Kirche, sondern auch zu Glauben und Heilsgewissheit vollkommen veränderte, die Geburt der modernen Naturforschung, aber auch Bauernkriege und Hexenverbrennungen. Ein Jahrhundert, das in jeder Hinsicht grundstürzend war - und das, wie Marina Münkler zeigt, viel mit uns verbindet. Ein großes Geschichtswerk über den Anbruch einer neuen Zeit, unserer Zeit.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.