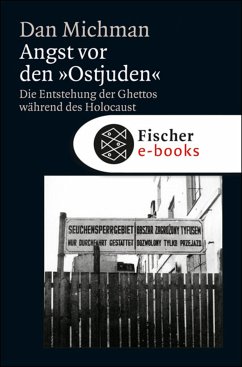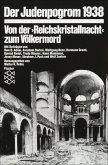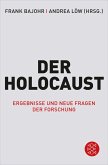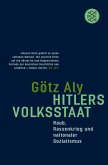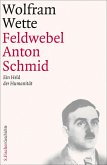Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Die Gettos waren kein zwangsläufiger Bestandteil der Judenvernichtung.
Von Marie-Janine Calic
Unmittelbar nach dem Überfall auf Polen im September 1939 begannen die Nationalsozialisten, die jüdische Bevölkerung in klar abgegrenzten Wohnbezirken zu konzentrieren. Mehr als tausend sogenannte Gettos wurden zum Symbol jüdischen Lebens und Leidens in den besetzten Ländern Osteuropas im Vorfeld der "Endlösung". Dan Michman geht der Frage nach, wann und unter welchen Umständen die Nationalsozialisten entschieden, solche Judenviertel zu errichten und welche Funktionen ihnen zukamen. Dabei stellt er herkömmliche Deutungen über Planmäßigkeit, Systematik und Finalität der Gettoisierung von Juden seit Herbst 1939 in Frage. Während der älteren Forschung die Gettoisierung als logische, wenn nicht notwendige Vorstufe zur Politik der totalen Vernichtung des europäischen Judentums galt, geht seine Argumentation in eine andere Richtung: Haupttriebkräfte seien nicht technisch-bürokratische Erfordernisse, sondern ideologische Prämissen gewesen, vor allem kulturell tief verwurzelte antisemitische Ressentiments. Der chronischen Angst vor den Ostjuden gab die Ostforschung in den dreißiger Jahren zudem einen pseudowissenschaftlichen Anstrich. Schriften wie Peter-Heinz Seraphims "Das Judentum im osteuropäischen Raum" formten und verstärkten das Stereotyp von den Ostjuden als existenzgefährdende, dunkle Macht.
Michman wählt einen kulturgeschichtlichen Ansatz, um zu erklären, warum sich die Nationalsozialisten den vierhundert Jahre alten Getto-Begriff aneigneten. Dessen semantischer Gehalt verwandelte sich von der ursprünglichen frühneuzeitlichen Bezeichnung eines sichtbaren, manchmal durch Mauern abgegrenzten Judenviertels in eine Metapher für die jüdischen Armenquartiere Osteuropas im 19. und frühen 20. Jahrhundert beziehungsweise für die soziale Isolierung von Juden mittels gesellschaftlicher Normen und Gesetze überhaupt. Zur Zeit des Nationalsozialismus begegnete man parallel verschiedenen Bedeutungen und Funktionen: Gettos dienten mal als Mittel zur Beschränkung jüdischer Freizügigkeit, mal fungierten sie als Orte der Konzentration von Zwangsarbeitern, zu guter letzt waren sie vor allem Sammel- und Durchgangslager für die Transporte im Rahmen der "Endlösung".
Dies führt zur zentralen These Michmans: Wenngleich die Einrichtung der Gettos eine Radikalisierung anzeigten, stellten sie an sich keine Vorstufe der "Endlösung" dar. Mit anderen Worten: Die Gettos waren kein zielgerichteter oder gar zwangsläufiger Bestandteil des Holocaust. Es existiere kein einziges bedeutendes Dokument, das auf ein umfassendes Programm zur Internierung der gesamten jüdischen Bevölkerung in abgeschlossenen Wohnbezirken hindeutete. Und nicht überall in Osteuropa entstanden Gettos, und wo es sie gab, erfüllten sie unterschiedliche Funktionen. Auch war es nicht Hitler selbst, der das Getto zum Instrument der Politik gemacht hätte; vielmehr wurden diese durch Entscheidungsträger der mittleren und unteren Ebene in den besetzten Gebieten eigenmächtig initiiert, "von Männern, die dem Regime ergeben, eingefleischte Antisemiten waren und denen ihre Vorgesetzten einen weiten Handlungsspielraum einräumten". Im Gegensatz zu der auf höchster Ebene getroffenen strategischen Entscheidung zur planmäßigen Vernichtung der Juden blieb die Einführung der Gettos seit 1939 vorläufig, geographisch beschränkt und in ihren Zielen diffus. Dass sie dennoch ihre monströse Funktionalität bei der Durchführung des organisierten Massenmords erwiesen, ist gleichwohl unbestritten.
Michman zeigt, dass Intention und Struktur als zwei Seiten derselben Medaille zu betrachten sind und dass es im Universum nationalsozialistischer "Judenpolitik" beides gab: den von höchster Stelle angeordneten großen Plan der Stigmatisierung, Isolation, Entrechtung und schließlich Vernichtung der europäischen Juden sowie daneben verschiedene Initiativen lokaler Akteure, die auf eine Radikalisierung der Judenverfolgung hinwirkten - zum Teil bereits, ehe sie von oben angeordnet wurde. Michmans überzeugende Darstellung der Gettopolitik wirft neues Licht auf die Geschichte der Judenverfolgung und Judenvernichtung.
Dan Michman: Angst vor den "Ostjuden".
Die Entstehung der Ghettos während des Holocaust. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main 2011. 281 S., 14,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH