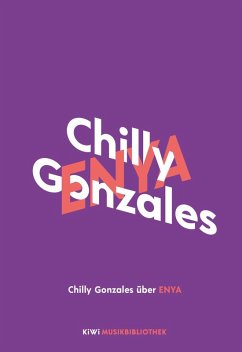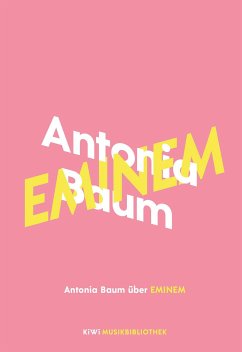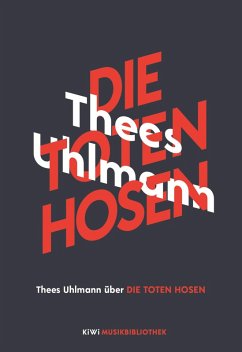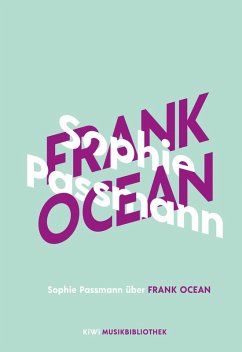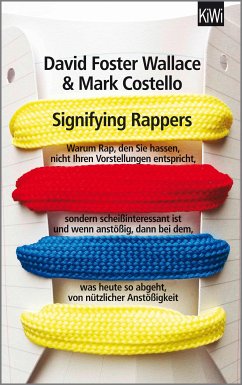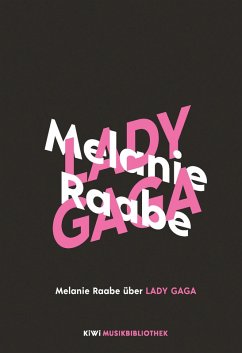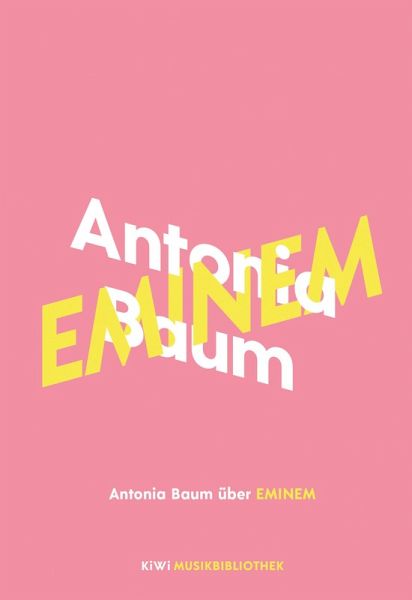
Antonia Baum über Eminem / KiWi Musikbibliothek Bd.8 (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 10,00 €**
8,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wie kriegt man als Frau die Verrenkung hin, Rap zu lieben und sich dabei permanent beleidigen zu lassen? Antonia Baum ist Schriftstellerin und Eminem gehörte einst zu ihren literarischen Vorbildern. Aber die Welt ist inzwischen eine andere geworden, bestimmte Aspekte der eigenen popkulturellen Biografie lässt man lieber verschwinden. Was also macht Antonia Baum zwanzig Jahre nach dem Rapklassiker »Stan« mit dieser misogynen, homofeindlichen, weißen Eminem-Leiche in ihrem Keller? Ist das Konzept »Leiche im Keller« eine gute Idee? Und kann es sein, dass Eminem trotz allem ein genialer Rap...
Wie kriegt man als Frau die Verrenkung hin, Rap zu lieben und sich dabei permanent beleidigen zu lassen? Antonia Baum ist Schriftstellerin und Eminem gehörte einst zu ihren literarischen Vorbildern. Aber die Welt ist inzwischen eine andere geworden, bestimmte Aspekte der eigenen popkulturellen Biografie lässt man lieber verschwinden. Was also macht Antonia Baum zwanzig Jahre nach dem Rapklassiker »Stan« mit dieser misogynen, homofeindlichen, weißen Eminem-Leiche in ihrem Keller? Ist das Konzept »Leiche im Keller« eine gute Idee? Und kann es sein, dass Eminem trotz allem ein genialer Rapper war?
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote