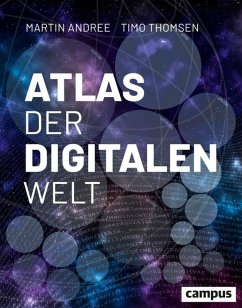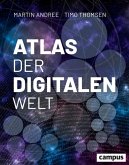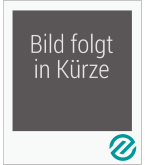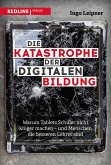Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Wer befürchtet, dass Facebook, Google, Amazon und Co. zu mächtig geworden sind im Internet, weiß dank der Zahlen aus dem neuen "Atlas der digitalen Welt" nun: Es ist noch viel schlimmer.
Es wird oft genug beklagt, dass die großen Online-Konzerne das Internet dominieren. Erst im August mussten die Chefs von Alphabet, Apple, Facebook und Amazon in einem Antitrust-Verfahren vor dem amerikanischen Kongress aussagen. Wie stark aber die digitale Konzentration genau ist, wie groß die Marktanteile der großen Plattformen sind, halten die Online-Konzerne bisher erfolgreich geheim. In jedem anderen Bereich der Medienlandschaft wissen wir, wie das Angebot ankommt - es gibt die Quote für das Fernsehen, die Auflagen der Zeitungen und Zeitschriften bei der IVW, die Bestsellerlisten bei Büchern. Nur die Sphäre, auf die es derzeit ankommt, hütet ihre Nutzungszahlen wie Coca-Cola sein Geheimrezept.
Dass nun ein bisschen Licht ins Dunkel kommt, ist einem Buch zu verdanken, das an diesem Wochenende bei Campus erscheint, dem "Atlas der digitalen Welt". Der Kölner Medienwissenschaftler Martin Andree und Timo Thomsen, ein Analyst der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), zeichnen darin ein Bild davon, wie wir das Internet benutzen. Welche Seiten besucht werden, wie lange und bei welchem Konzern. Das ist einzigartig in dieser Genauigkeit. Es gab zwar schon immer viele Daten, etwa Klickzahlen von Artikeln, Besucherzahlen auf Websites oder Umfragen unter Nutzern, aber sie waren immer fragmentarisch und schlecht vergleichbar. Wer forschen wollte, war von der Gunst der Unternehmen abhängig.
Eine Ausnahme ist das sogenannte GfK Crossmedia Link Panel, ein Instrument der Marktforschung, das bei 16 000 repräsentativ ausgewählten Deutschen installiert ist und ihr Online-Verhalten beobachtet. Also eigentlich ganz analog zu der Art, wie die Quote für das Fernsehen ermittelt wird. Das echte Verhalten wird dabei dokumentiert: Wie viel Zeit verbringt man auf einer Seite? Wo geht man von dort aus hin? Wie verteilt sich die Zeit im Internet auf Shopping, Nachrichtenlesen, Social Media etc.? Von alldem bekommt man jetzt erstmals eine Ahnung, die GfK hat einen Teil dieser Daten erstmals offengelegt.
Und das Ergebnis ist erschütternd. Ein zentraler Satz des Buches lautet: "Die Konzentration des gesamten Traffic auf nur sehr wenige Konzerne ist deutlich größer als vermutet." Die sieben größten Unternehmen der digitalen Welt haben zurzeit mehr als 50 Prozent der gesamten Internetnutzung auf ihren Seiten, auf den weiteren Plätzen geht es exponentiell rasant bergab: 71,8 Prozent der Verweildauer konzentrieren sich auf die 100 meistgenutzten Internetadressen. Dabei nutzen die Teilnehmer der Stichprobe in den drei Monaten der Datenerhebung insgesamt 131 993 Websites oder Apps, die meisten davon aber eben nur sehr kurz. 85,8 Prozent ihrer Online-Zeit verbrachten sie auf den Seiten der 500 stärksten Plattformen, also bei den oberen 0,38 Prozent. Übertragen auf die vielbeklagte soziale Ungleichheit, wäre dieses Verhältnis beinahe der Zustand, in dem eine einzige Person das gesamte Vermögen des Landes innehätte.
Mit mehr als 100 Infografiken zeigt das Zahlenwerk unmissverständlich, dass das große Versprechen des Internets gescheitert ist. Vor zwanzig Jahren hofften die Gurus und Apologeten der neuen Online-Welt, dass das Internet die einzelnen Nutzer stärken werde. Chris Anderson etwa, der damalige Chefredakteur von "Wired", pries in seinem berühmten Buch "The Long Tail" die Nischenprodukte, die kleinen Unternehmen, die alle jetzt ermächtigt würden, sich zu behaupten. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Dieser Traum ist geplatzt. Das betrifft auch den Kulturbereich. Blogs etwa, die lange Zeit als Mittel der publizistischen Ermächtigung galten, sind - das zeigen die Zahlen - praktisch unbedeutend. Ein Siebtel der Menschen schaut überhaupt mal auf einen Blog, das aber im Durchschnitt nur zwei Minuten im Monat.
Solche Informationen reiht das Buch Seite für Seite aneinander, 83,3 Prozent der Deutschen über 14 sind regelmäßig online (damit aber auch: fast zwölf Millionen nicht). Das Smartphone wird inzwischen von allen Geräten am längsten genutzt, mehr als der Computer. Auf Amazon und Ebay verbringen die Kunden etwa eine Stunde im Monat - bei Otto, dem ersten deutschen Unternehmen der Einkaufs-Top-Ten, dagegen nur sechs Minuten.
Wie die Unternehmen diese Dominanz erreichen konnten, auch darauf geben die Zahlen Hinweise. Vor allem den großen vier (Alphabet, Amazon, Apple, Facebook) gelingt es sehr effektiv, die Nutzer im eigenen Firmenkosmos zu halten. 36 Prozent aller User landen nach der Nutzung von Facebook bei einem anderen Angebot des Konzerns (also etwa auf Instagram oder Whatsapp). Dabei ist der Marktanteil von Facebook (am gesamten Online-Traffic) nur 7,4 Prozent. Beim Alphabet-Konzern, der Mutter von Google und Youtube, ist es ähnlich: Klickt man auf irgendetwas, landet man in 35 Prozent der Fälle wieder bei Alphabet. Auch dieses Unternehmen ist mächtig, vereint aber nur knapp 19 Prozent des Traffic bei sich. Das hilflose "Link in Bio", das auf Instagram Hunderttausende in ihre Posts schreiben, ist der wohl bekannteste Auswuchs davon: Instagram verbietet Links, die woanders hinführen. Nur in der Selbstbeschreibung (der "Bio") geht dies einmal.
Der "Atlas der digitalen Welt" schlägt oft einen furchtbaren Management-Ton an: Da finden Dinge "in 2020" statt, es gibt eine "360 Grad Darstellung" der digitalen Welt (ohne Bindestriche), die Daten sind "hochwertigst". Aber wenn man bereit ist, über die denglischen Wendungen hinwegzusehen, deckt das Buch einen handfesten Skandal auf: Der Wettbewerb am digitalen Markt ist noch viel verzerrter als jeder andere. Und wir Nutzer und Kunden wussten das bisher nicht, weil die Unternehmen alles geheim halten wollen.
Seit dem Cambridge-Analytica-Fall von 2018, als Big Data gezielt benutzt wurde, um den amerikanischen Wahlkampf zu manipulieren, hatte Facebook eine Transparenzoffensive nach der anderen versprochen. Es folgten allerdings keine Taten. Zuletzt sind die Verhandlungen zwischen der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) und Google gescheitert. Fünf Jahre lang wurde darüber diskutiert, Youtube in das System der AGF zu integrieren - dann wären TV-Reichweiten und Youtube-Zahlen endlich vergleichbar. Die Werbewirtschaft forderte das schon lange. Doch Youtube wollte sich den deutschen Standards nicht beugen - aus demselben Grund platzten übrigens auch die Verhandlungen mit der britischen Quotenermittlung Broadcasters' Audience Research Board BARB. In Deutschland hat Google letztlich einfach seine Daten nicht abgeliefert. Die Internetriesen wollen sich nicht in die Karten schauen lassen. Man fragt sich schon ein wenig, wann und mit welchen Tricks sie wohl den neuen "Atlas" stoppen und vom Buchmarkt nehmen werden.
Auf Netflix ist gerade die Dokumentation "Das Dilemma mit den sozialen Medien" in den Top Ten der Zuschauer. Ehemalige Manager des Silicon Valley sprechen voller Reue über die raffinierten Tricks, die sie selbst mitentwickelt haben, um die Nutzer zu gewinnen, zu verführen und in Blasen gefangen zu halten. Einer, der bei Google ausstieg, sagt darin den Satz: "Damals dachte ich, dass das alles einem guten Zweck dient. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so sehen würde."
Die Doku funktioniert weitestgehend ohne Zahlen, sie lebt von den enttäuschten Gesichtern der Managerinnen und Manager, die früher mal an die digitale Revolution geglaubt haben. Alle wirken sehr traurig, den ganzen Film über wird kaum gelacht.
THOMAS LINDEMANN
Martin Andree und Timo Thomsen: "Atlas der digitalen Welt". Campus Verlag, 272 Seiten, 32 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main