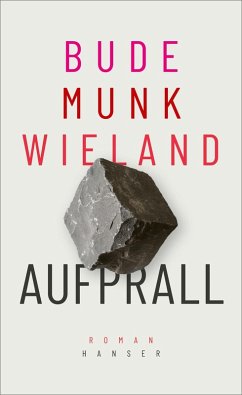Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Vor 40 Jahren haben die Berliner Hausbesetzer einen Stil geprägt, der die ganze Welt erobert hat. Ein Rundgang mit drei Revoluzzern von einst.
Von Ralph Bollmann
Karin Wieland gerät ins Schwärmen, ausgerechnet über einen schnöden Supermarkt der längst entschwundenen Discounterkette "Plus". Etwas ganz Besonderes sei dieser Ort gewesen, hier hätten gleichermaßen Hausbesetzer, deutsche Rentner und türkische Familien eingekauft, allesamt respektvoll behandelt vom Personal mit seiner typischen Berliner Unbeeindruckbarkeit.
Inzwischen nächtigen Touristen in dem historischen Kaufhaus, das von 1925 bis 1956 den Klamottenhändler C&A Brenninkmeyer beherbergte. Der bayerische Hotelier Dietmar Müller-Elmau hat daraus das "Orania" gemacht, benannt nach der Lage am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg. Anfangs wurden aus Protest gegen den Eindringling schon mal die Scheiben eingeworfen. Heute zuckt die ehemalige Hausbesetzerin Wieland nur die Schultern: Der Laden gibt ihr nichts, aber aufregen mag sie sich darüber auch nicht, bei allem, was sich hier sonst noch so verändert hat.
Jetzt hat Karin Wieland, die Sachbuchautorin, einen Roman mit dem Titel "Aufprall" geschrieben, mit ihrem Mann, dem Soziologen Heinz Bude, und einer gemeinsamen Freundin, der Künstlerin Bettina Munk. Es geht darin um ihre eigenen Geschichte, wie sie aus Westdeutschland nach Berlin kamen und Anfang 1981 ihr erstes Haus besetzten. Ein schwerer Autounfall, eine polizeiliche Räumung, schließlich die Legalisierung des Mietverhältnisses und der Aufbruch in eine etabliertere Existenzform bieten den Rahmen für die Vermessung einer ganzen Generation - Begegnungen mit deutscher Geschichte und Realsozialismus inklusive, mit neuen Geschlechterverhältnissen, aber auch mit Krankheit und Tod.
Nun wollen sie auf einem Spaziergang durch SO 36, wie dieser hinterste Winkel des alten West-Berlins nach dem Postzustellbezirk heißt, die Schauplätze von einst zeigen - und dabei erkunden, was vom Berlin der Achtziger geblieben ist in dem Getümmel der englischsprachigen Hipster ("currently based in Berlin"), die diesen Teil der Hauptstadt zuletzt so sehr verändert haben wie kaum einen sonst. Gut zwanzig Seiten widmet der Lonely-Planet-Reiseführer dem Bezirk, so viel wie keinem anderen außerhalb der historischen Mitte.
Eine gewisse Reserve, über dieses neue Kreuzberg zu sprechen, ist bei den dreien anfangs zu spüren. Die Gefahr ist groß, entweder bloß in vergangenen Heldentaten zu schwelgen oder nur als Staffage für durch Corona unterbrochenen Party-Zirkus herhalten zu müssen. "Staffage will man nicht sein", sagt Bude entschieden. "Wir gehören weder zum Stadtmarketing noch zur Nostalgie-Fraktion."
Die leichte Befangenheit legt sich bald. Beim Gang durch die Oranienstraße sprudelt es aus den Autoren heraus: hier die Kneipe, wo vorne die Säufer abhingen und man sich hinten auf der Toilette vor der Polizei verstecken konnte; dort die schwule Bar, wo die Kellner nicht dem Zwang zur alles beherrschenden Schluffigkeit unterlagen. Das Frauencafé, ein "Safe Space", als das noch gar nicht so hieß. Dann das Farbengeschäft, das noch dem frühen 20. Jahrhundert entstammte und sich über alle Zeiten gehalten hat, und die Galerie, die nach der Wende ins angesagte Berlin-Mitte umzog. Schließlich das Hausprojekt, das sich mit rund 50 Bewohnern schon früh so bürokratisch durchorganisierte, samt Putzplänen und Kochdiensten, dass es im Gegensatz zu anderen Gemeinschaften die Zeiten überdauert hat.
Dabei würde es das alles ohne die Besetzer vermutlich gar nicht mehr geben. Die Berliner Stadtpolitik hatte andere Pläne. Die Oranienstraße mit ihren Altbauten sollte dem Verkehr weichen, genauer: der "Südtangente". Als Bundesautobahn mit der Nummer 106 hätte sie die Gegend um den Potsdamer Platz quer durch das nördliche Kreuzberg mit dem Gelände des früheren Görlitzer Bahnhofs und dem damals zum Osten gehörenden Treptow verbunden: Man plante noch immer für eine mögliche Wiedervereinigung. Auf dem Oranienplatz hätte sie in einem gigantischen Autobahnknoten die A 102 gekreuzt, die "Osttangente" bis hinunter zum Volkspark Hasenheide und dem Flughafen Tempelhof.
Dazwischen plante der SPD-geführte Senat neue Wohnsiedlungen in Plattenbauweise, die den Arbeitern endlich Wohnungen mit Vollkomfort verschaffen sollten statt der alten Elendsquartiere mit Ofenheizung und Außenklo, die in den Augen der älteren Generation bloß an schlechte Zeiten erinnerten. Also ließ man die Gründerzeitbauten leer stehen und verfallen, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften gingen dabei voran. Als Zwischennutzer waren allenfalls Einwanderer aus der Türkei willkommen, denn sie würden - wie der Name "Gastarbeiter" schon sagte - einer damals weitverbreiteten Überzeugung zufolge ja bald wieder gehen. Ansonsten veranstalteten die amerikanischen Streitkräfte in den halb ruinösen Straßen ihre Manöver.
Dann kamen die jungen Leute, die in West-Berlin keine Wohnung fanden. Das Procedere war entwürdigend, mehr noch als heute. Es galt, Samstag Nacht bei einer alten Händlerin am Bahnhof Zoo die ersten Exemplare der frisch gedruckten Sonntagszeitungen zu ergattern, in rasendem Tempo die Wohnungsannoncen zu erfassen, mit vorher abgezähltem Kleingeld die nächste Telefonzelle zu erobern - um dann bei einem hart erkämpften Besichtigungstermin womöglich nur abgewiesen zu werden, weil dem Vermieter das Outfit nicht zusagte. Heute kommt es mehr auf den Geldbeutel als auf Konformismus und Ellenbogen an. Man mag das, je nach Sichtweise, als Fortschritt empfinden.
Dass - anders als heute - zur selben Zeit so viele Wohnungen leer standen und auf den Abriss warteten, wirkte wie eine Provokation. Also entschlossen sich Leute wie Bude, Munk und Wieland, die Schlösser der halb ruinösen Häuser aufzubrechen und es sich mit ein paar Matratzen auf dem Fußboden gemütlich zu machen, sofern Gemütlichkeit überhaupt als erstrebenswertes Ziel galt.
So romantisch, wie sich das heute manche vorstellen, war das nicht - und auch nicht so einfach wie in der DDR, wo etwa Angela Merkel die von ihr heimlich besetzte Wohnung kurzerhand durch den Gang zum Einwohnermeldeamt legalisieren konnte. Schließlich war Hausfriedensbruch eine Straftat, die von den Behörden energisch verfolgt wurde, erst recht, seit der christdemokratische Hardliner Heinrich Lummer im Sommer 1981 das Amt des Berliner Innensenators übernommen hatte. Munk und Wieland wurden verurteilt, was zumindest für die Künstlerin auch berufliche Folgen hatte: Sie konnte ein Stipendium in New York nicht antreten, weil das amerikanische Konsulat aufgrund der Vorstrafe das Visum verweigerte.
Die Leute vom Hanser-Verlag im beschaulichen München sollen bei der Lektüre des "Aufprall"-Manuskripts ein wenig irritiert gewesen sein über das Ausmaß der Gesetzlosigkeit, dem sich ihre Autoren einst hingaben. Das war schon etwas anderes, sagt Wieland, als der kommerzialisierte Widerstand einer Luisa Neubauer von "Fridays for Future" oder das politische Engagement eines erfolgreichen Pianisten wie Igor Levit. Trotzdem würde sie das Besetzen von Wohnraum auch der heutigen Generation empfehlen - vorausgesetzt, es finden sich überhaupt leerstehende Wohnungen. Auf die Mietpreisbremse angesprochen, die der Berliner Senat jüngst beschloss, schütteln alle drei dagegen den Kopf. "Da wird das Spontane ersetzt durch eine zentrale Ordnung", schimpft Bude. "Das wollen wir nicht, gerade aus dem Besetzer-Impuls heraus." Für bezahlbaren Grund und Boden müsse man dagegen durchaus sorgen, etwa durch Erbpachtverträge oder vergünstigte Grundstücke für Baugenossenschaften.
Anders als heutige Wohnraum-Aktivisten richteten die Besetzer ihre Hoffnungen nicht auf den Staat. Im Gegenteil: Der Staat repräsentierte ja das System, gegen das sie sich mit ihrer Selbstorganisation auflehnten. Als später die Alternative Liste, der Berliner Zweig der Grünen, an Einfluss gewann, als besetzte Häuser legalisiert wurden und Geld für Sozialprojekte floss, spaltete die Frage die Bewegung. "Staatsknete" annehmen: ja oder nein?
Der Berliner Innensenator, der Nachrüstungs-Kanzler Helmut Schmidt, der amerikanische Präsident Ronald Reagan: Das waren die Feindbilder. Als Reagan 1982 nach Berlin kam, lieferten sich Besetzerszene und Polizei eine Auseinandersetzung, die als "Schlacht am Nollendorfplatz" in die Lokalgeschichte einging.
Kritik am Kapitalismus dagegen stand, anders als bei den Achtundsechzigern, nicht so sehr im Zentrum. Geld war anfangs ohnehin nicht so wichtig, auch, weil es nicht da war. Man kochte Spaghetti mit Knoblauch und Öl, trank einfachen Rotwein in allerdings nicht unerheblichen Mengen und trug gebrauchte Klamotten. Als mal ein Australier zu Besuch kam und ein veganes Menü mit roten Linsen zauberte, galt das schon als kulinarische Offenbarung.
Auch der rauhe Charme ringsherum hatte wenig mit dem Kreuzberg von heute zu tun. Türkische Familien waren die letzten, die zwischen all dem Verfall ein geordnetes Leben aufrechterhielten; zum Dank dafür mussten sie ausziehen, als die Besetzer ihre Mietverträge bekamen und die Häuser schick renovierten. Auch das kommt in dem Buch am Rande vor. Die angestammten Bewohner hatten sozialdemokratische Stadtregierungen längst in die Plattenbauten der Gropiusstadt oder des Märkischen Viertels ausgesiedelt. Es blieben mit deutscher Muttersprache vornehmlich Arme, Alte oder Alkoholiker zurück. Sie berlinerten auf eine Weise, wie man das heute kaum noch kennt. Auch Sozialfiguren wie die im Roman beschriebene resolute Kohlenhändlerin sind heute kaum noch anzutreffen.
Die Straßen waren breit und leer, selbst in den neunziger Jahren bemerkten Neuankömmlinge neben dem Kohlengeruch vor allem das Fehlen von Menschen als den auffallendsten Zug des damaligen West-Berlins. Allenfalls im Corona-Lockdown des vorigen Frühjahrs ließ sich eine Ahnung davon gewinnen, wie es damals in der Stadt zuging. Jetzt, zum Jahresende, herrscht schon wieder der Trubel des neuen Berlins, zumal auf der Oranienstraße kaum ein Geschäft geschlossen hat: Take-away-Imbisse reihen sich an Spätkauf-Läden, Optiker an Buchhandlungen, die in der Hauptstadt ebenfalls zur Grundversorgung zählen.
So sehr sich Kreuzberg seit den Achtzigern verändert hat: Damals entstand hier ein Lebensstil, der sich später über die ganze Republik und weit darüber hinaus verbreitete. Das fängt schon mit dem Wohnen an. Der Altbau, die abgezogenen Dielen, der Bedeutungsverlust des Wohnzimmers zugunsten der jetzt gemeinschaftlichen Küche, in der früher nur die Hausfrau eingesperrt war: Der Kreuzberg-Style trat wenig später seinen Siegeszug um den Globus an. "Wir haben's erhalten", sagt Wieland dazu. "Was heute auf die Jugend der Welt so interessant wirkt, das ist durch uns bewahrt worden - und aufgewertet, weil es als Rebellion funktioniert." SO 36, damals das Ende der Welt, ist eine Marke geworden.
Bude und Wieland zogen daraus eine radikale Konsequenz: Sie bewohnen heute einen Neubau im Randbezirk Weißensee. Bude wäre nicht Bude, würde er das nicht mit der Polemik des Soziologen zuspitzen. "Wir sind mittlerweile die absoluten Gegner von Altbau-Spießern", sagt er. "Altbau-Spießer kommen uns nicht ins Haus." Er gibt freilich zu, dass sich das ohne Risiko der Vereinsamung kaum verwirklichen lässt: Zu sehr hat sich sein eigener Lebensstil von einst heute allgemein durchgesetzt, wenigstens im akademischen Milieu. Wer in der Pandemie an Zoom-Konferenzen mit Berliner Journalisten, Politikern oder Regierungsbeamten teilnimmt, blickt im Hintergrund allenthalben auf Sprossenfenster und Schnörkeltüren aus dem Kaiserreich.
Aber es blieb nicht nur beim Wohnen und auch nicht bloß bei der Subsistenz-Ökonomie in der "Home Bar", der Besetzerkneipe mit dem Pfälzer Wein, immerhin ein Direktimport vom Winzer. Viele der Läden, die während der achtziger Jahre entlang der Oranienstraße entstanden, nutzten nach dem Fall der Mauer die Chance und expandierten erfolgreich in die neue Mitte Berlins, wo sie oftmals die weitaus größeren Geschäfte machten - ob es nun der Optiker war oder der Weinladen mit dem schönen Namen "Suff". Das türkische Gastro-Imperium "Hasir" belegt inzwischen einen ganzen Straßenzug, neben dem Döner-Imbiss gibt es längst auch einen Burger-Laden und ein Steakrestaurant gleichen Namens. Der Gastronom Stephan Landwehr, der heute den Grill Royal und ein paar andere Treffpunkte des neuen Berlins betreibt, begann seine geschäftliche Karriere mit einem Laden für selbstgefertigte Bilderrahmen in Kreuzberg.
Merkwürdigerweise war der kommerzielle Erfolg der einstigen Weggefährten manchmal besser und manchmal schlechter gelitten. Als mit dem "Maxwell" in den Neunzigern zum ersten Mal ein wirklich gehobenes Restaurant eröffnete, wurden kübelweise Fäkalien aus Protest in den Gasträumen ausgekippt. Dass Kreuzberg heute zu den Stadtvierteln mit den meisten Michelin-Sternen in Deutschland zählt, stört hingegen kaum noch jemanden.
Aber wonach richtet es sich, welche Form von kommerziellem Erfolg akzeptiert wird und welche nicht? "Soziologisch würde man sagen: Das entscheidet sich an einem kulturellen Faktor", sagt Bude. "Es gibt blöde Geschäftemacher, und es gibt korrekte Geschäftemacher. Wahrscheinlich sind wir ziemlich treu. Sich ins gemachte Nest zu setzen und zu sagen: Ich bin mal sehr schlau und mache hier eine Kette auf - das ist langweilig."
Und, natürlich: die Kultur. Der Filmregisseur Wim Wenders, der seine Produktionsfirma gleich beim Oranienplatz betrieb und im "Himmel über Berlin" seinen Engel, nicht frei von Kitsch, gleich in der Nähe landen ließ. Der Kunsthändler Bruno Brunnet, der anfangs im "Exil" am Landwehrkanal kellnerte und später die Galerie "Contemporary Fine Arts" in Charlottenburg eröffnete. Die Künstlergruppe "endart", die sich dem Kommerz verweigerte und ihren Galeristen Paul Maenz damit zur Verzweiflung trieb, wie Munk belustigt erzählt. Dazu die kleinen Verlage mit ihrer feministischen Literatur, die später Mainstream wurde, nur ohne das Schubladendenken von heute: "Das Fluide war damals viel fluider", wie Munk sagt. Oder die kleinen Kinos, von denen Wieland schwärmt: "Heute würde sich jedes Theater, jedes Museum die Finger danach schlecken, so eine Mischung hinzukriegen, die aber rein zufällig war - Lesungen, Konzerte, Film, Theater. Da hat niemand gesagt, wir machen ein Konzept. Das ist heute in der Mitte angekommen." Und es hat die Urheber überflüssig gemacht: Das Eiszeit-Kino am Lausitzer Platz, vor dem Wieland gerade steht, ist seit gut zwei Jahren geschlossen.
Schon länger kursiert die These, dass der Individualismus der Besetzergeneration dem oft geschmähten "Neoliberalismus" erst den Weg bereitet hat. Da zögern die drei Autoren. "Wir waren auch kollektivistisch, sogar das Buch haben wir im Kollektiv geschrieben", beharrt Wieland. "Wir sind schon an dieser Revolution des Ich beteiligt", gibt Bude dagegen zu. "Das war ja kein vorgestanztes Kollektiv, es war ein selbstgemachtes, ein eingegangenes Kollektiv, zusammengehalten durch ein Konzept von Lebenskunst." Spontane Ordnung, Entdeckungsverfahren: Da sieht Bude sogar Parallelen zu Theoretikern des freien Marktes wie Friedrich August von Hayek oder zur schöpferischen Zerstörung als Prinzip des Kapitalismus, über die Joseph Schumpeter einst schrieb.
Nur eines wollte keiner haben: einen klassischen Nine-to-five-Job wie die Eltern. "Ich will nicht werden, was mein Alter ist", sang Rio Reiser schließlich. "Dabei ist die Gig-Economy herausgekommen", sagt Munk: In scheinbarer Autonomie hantiert man mit wechselnden Aufträgen. Um die Rente hat man sich dabei nicht gesorgt. "Viele haben gesagt: Mit vierzig bring' ich mich eh um." Die Jobaussichten für Akademiker waren ohnehin nicht rosig: Geburtenstarke Jahrgänge und staatliche Finanznöte trafen auf ungünstige Art zusammen. Lehrer wurden nicht mehr eingestellt, eine halbe Projektstelle an der Uni galt schon als Hauptgewinn.
Den Stil der Besetzer nennt Bude "praxisorientiert", in Abgrenzung zum Theoretisieren der vorausgegangenen Achtundsechziger-Generation. Die Babyboomer würden immer nur als hemmungslose Pragmatiker beschrieben, die sich an alles anpassen könnten. Dabei stecke darin auch ein Element des Experimentellen, des Ausprobierens, wie weit man gehen kann - und des Austestens von persönlichen Grenzen, wie es die scheidende Bundeskanzlerin mal beschrieb. "Merkels Pragmatismus ist ja auch bei uns mit drin", sagt Wieland. "Sie ist eigentlich eine von uns", ergänzt Bude.
Aber damit haben die drei Autoren ihre Kreuzberger Zeit schon hinter sich gelassen. Sie schlagen einem Abstecher ins weiter westlich gelegene, etabliertere Schöneberg vor. Weniger, weil dort die "Schlacht am Nolli" stattfand oder nach der Räumung eines Hauses an der Bülowstraße ein Besetzer unter den Rädern eines Linienbusses starb, nachdem ihn die Polizei in den fließenden Verkehr getrieben hatte. Nein, es geht um eine neue Lebensphase. Und die erste Station ist wiederum ein Unternehmen, das seinerzeit enorm erfolgreich war: der Merve-Verlag mit seinen spartanisch ausgestatteten Büchlein, die zunächst vor allem Texte französischer Philosophen enthielten und sehr viel später auch den Essay über die "Generation Berlin", der Bude über Fachkreise hinaus bekannt machte.
Fast schon theatralisch stellt sich der Soziologe vor dem früheren Verlagsgebäude auf und sagt den Satz, den er sich für die Gelegenheit zurechtgelegt hat: "Wir waren die Praxis, zu der Merve die Theorie lieferte." Befreiend, sagen die Ex-Besetzer, hätten sie den Abschied vom "Marxismus-Wahnsinn" der Siebziger gefunden, der auch eine Abkehr vom Primat des Ökonomischen bedeutete. Bude deutet auch das wieder soziologisch: "Die Wünsche sind mindestens so wichtig wie die Interessen." Die klassische SPD, die Plattenbauten attraktiver fand als Wohnküchen im Altbau, habe davon keinen Begriff gehabt: Das Ende ihrer kulturellen Hegemonie deutete sich wohl damals schon an.
Die Bücher wurden verschlungen, wie man es sich heute kaum noch vorstellen kann. Verstanden hat man sie nicht in jedem Fall. "Man liest die Texte immer wieder - halb betrunken, ganz betrunken, nüchtern", sagt Wieland. "Jedes Mal ergeben sie einen anderen Sinn." So war die Lektüre der Autoren mit ihrer französischen Eleganz vor allem auch eines: schick. Aus der "Home Bar" im besetzten Haus ging es in die grell ausgeleuchtete Neonbar im Schöneberger Kiez, und die Männer fingen auf einmal an, sich Brioni-Anzüge zu kaufen. "Zu Merve konnte man sehr gut im Anzug gehen", freut sich Bude noch heute.
Merkwürdig nur, dass von dieser Schöneberger Zeit so wenig geblieben ist. Der Merve-Verleger starb verarmt in Thailand, von angesagten Bars hat man lange nichts gehört, von intellektuellem Diskurs ganz zu schweigen. Nur die schwule Szene gibt es noch, aber die war schon da, lange bevor die Ex-Besetzer aus Kreuzberg eintrafen.
Ein Lichtblick immerhin folgt: Kurz vor dem Ende des Rundgangs stößt das Autorentrio auf einen ziemlich angesagten Bäcker, der Brot nach Mailänder Rezepten und hausgemachte Pizza anbietet, eine willkommene Stärkung nach fast vier Stunden im grauen Berliner Dezember. Die Sache hat nur einen Haken: Der Laden ist eine Dependance des Bäckers aus der Markthalle IX, dem Hipster-Hotspot in SO 36. Im leicht verschlafenen Schöneberg kommt jetzt das Schicke aus Kreuzberg herüber. So werden Bude, Munk und Wieland auch hier von der eigenen Vergangenheit eingeholt - und vom Kreuzberg-Style, der heute scheinbar alles prägt.
Heinz Bude, Bettina Munk, Karin Wieland: Aufprall. Roman, Hanser, München 2020, 384 Seiten, 24 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main