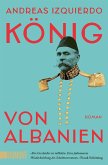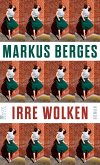Christine Lavant verarbeitet ihren Aufenthalt in der Psychiatrie literarisch: eine Lektüre, die unter die Haut geht. Sechs Wochen verbrachte Christine Lavant als Zwanzigjährige in der »Landes-Irrenanstalt« Klagenfurt, nachdem sie einen Suizidversuch mit Medikamenten unternommen hatte. Elf Jahre später, im Herbst 1946, schrieb sie über diese Erlebnisse mit Patientinnen, Pflegerinnen und Ärzten in der Institution Psychiatrie. Vor allem aber: über ihre Selbstwahrnehmungen, die Zustände des eigenen Bewusstseins und Unterbewusstseins in dieser existenziellen Situation. Überscharf und mit höchster Intensität setzt die Autorin konkrete Situationen ins Bild, den Klinikalltag, die Behandlungen und die implizite Gewalt, und alles ist durchdrungen von apokalyptischen Phantasien. Anfang der fünfziger Jahre plante Christine Lavant mit ihrem damaligen Verleger eine Veröffentlichung, allerdings konnte die Autorin sich schließlich doch nicht dazu durchringen: Der Verleger war offensichtlich begeistert, hatte jedoch einen »frommen Schluss« verlangt. Zu Lebzeiten wurde der Text auf Deutsch nie veröffentlicht. Lediglich eine ins Englische übersetzte Funkerzählung sendete die BBC 1959. Dass der deutsche Text überhaupt erhalten ist, verdankt sich der Übersetzerin Nora Wydenbruck, in deren Nachlass man ihn Mitte der neunziger Jahre fand. 2001 wurde er erstmals publiziert; jetzt liegt er neu ediert vor.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.