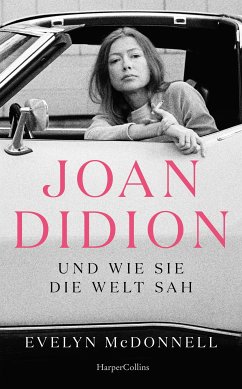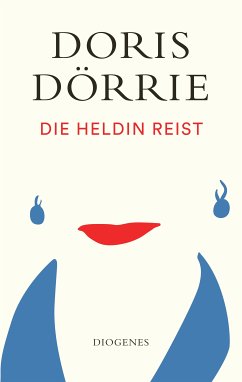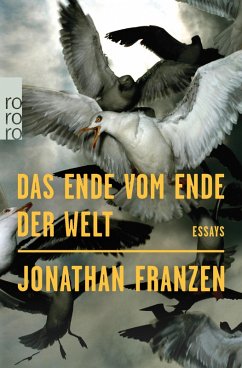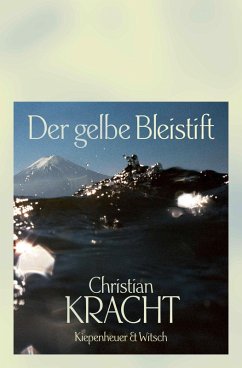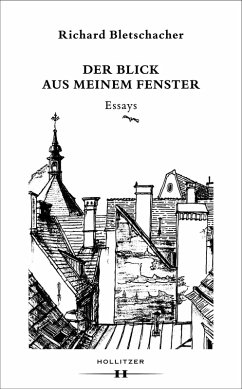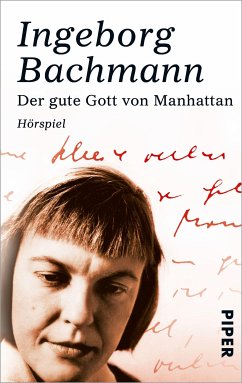Ausflug mit dem Zerberus (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 19,90 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Ich stellte mir vor, ich wäre der Hundesitter der Unterwelt, und Persephone hätte mich rufen lassen, damit ich den Zerberus spazieren führe. Wie sieht der dreiköpfige Wachhund des Hades aus? Wohin mit ihm Gassi gehen?" Mirko Bonné wählt die ganze Welt für seinen Spaziergang mit dem Höllenhund. Die Reise führt nach Südamerika und in die Antarktis, nach New York und Amsterdam, an die Orte seiner Kindheit und Familie, auf den Mond und zurück.Den drei Augenpaaren des Zerberus entgeht nichts: Detaillierte, poetische Reisebetrachtungen wechseln in diesen klugen und zugleich unterhaltsame...
"Ich stellte mir vor, ich wäre der Hundesitter der Unterwelt, und Persephone hätte mich rufen lassen, damit ich den Zerberus spazieren führe. Wie sieht der dreiköpfige Wachhund des Hades aus? Wohin mit ihm Gassi gehen?" Mirko Bonné wählt die ganze Welt für seinen Spaziergang mit dem Höllenhund. Die Reise führt nach Südamerika und in die Antarktis, nach New York und Amsterdam, an die Orte seiner Kindheit und Familie, auf den Mond und zurück.Den drei Augenpaaren des Zerberus entgeht nichts: Detaillierte, poetische Reisebetrachtungen wechseln in diesen klugen und zugleich unterhaltsamen Beobachtungen ab mit Exkursionen in die Kunstgeschichte, Erinnerungen an Strandurlaube und Clubkonzerte mit Überlegungen zu Leben und Literatur. Unterwegs auf den Spuren von Trakl, Sebald, Camus und Whitman erzählt der Autor auch von der Entstehung seiner eigenen lyrischen Werke und Romane so geistreich wie leichthändig, so kritisch wie weltoffen."
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.