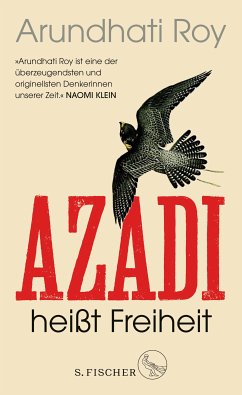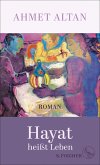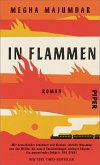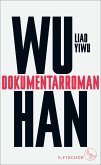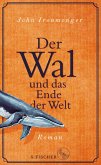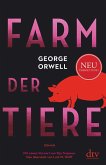Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Arundhati Roys aktuelle Essays
Überblickt man die Literatur, die von Indien zu uns herüberschwappt, finden sich immer seltener jene großen Autoren, auf deren Romane man sich freute. Amitav Ghoshs letzte Bücher sind nicht ins Deutsche übersetzt worden, auch nicht die von Amit Choudhuri und Shashi Tharoor. Vikram Seths langerwartete Fortsetzung von "Eine gute Partie" ist noch nicht erschienen. Eine Ausnahme bildet die Schriftstellerin Arundhati Roy. Ihre Aufsatzsammlungen und zuletzt ihr zweiter Roman "Das Ministerium des äußersten Glücks" (2017) sind auf Deutsch erschienen, obwohl sie eine Wirklichkeit darstellen, die mit der deutschen wenig Berührung hat. Das gilt auch für ihren jüngsten Essayband unter dem bewusst provozierenden Titel "Azadi" - das Wort für Freiheit in Urdu.
Arundhati Roy war mit ihrem ersten Roman, "Der Gott der kleinen Dinge" (1987), pfeilschnell zu Weltruhm aufgestiegen. Danach schrieb sie zwanzig Jahre lang Essays und Reden, die sie als Aktivistin bekannt machten. Sie streitet für die Rechte der Ureinwohner-Stämme, der Dalits (die indischen Armen) und der kaschmirischen Bevölkerung, gegen den Bau des Narmada-Staudamms in Nordindien, gegen Kapitalismus und Zerstörung der Umwelt durch die Großindustrie.
Generell steht Roy in Opposition zum soziopolitischen Establishment in Indien und weltweit. Darum kann sie sich mit keiner Partei und keiner Regierung arrangieren. Nicht einmal eine Lichtgestalt wie Barack Obama ließ sie gelten. Seitdem 2014 die hindunationalistische Bharatiya Janata Party in Indien an die Macht kam, ist sie deren eingeschworene Feindin und drischt literarisch wie mit einem Knüppel auf deren Premierminister Narendra Modi ein. Die Essays im vorliegenden Band wurden von 2018 bis 2021 verfasst und behandeln die in jener Zeit brodelnden nationalen Streitfragen. Angeprangert werden die Inhaftierung zahlreicher Bürgerrechtler, die wachsende Lynchjustiz, die Benachteiligung und Schikanierung der muslimischen Minderheit, Korruption auf allen Ebenen, der Versuch im Bundesland Assam, zahlreichen Muslimen ihre Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Das geschieht in der Roy eigenen aufgeregten, weder Selbstzweifel noch Differenzierung duldenden Haltung.
Wohlgemerkt, den Hindu-Nationalismus als eine Gefahr für Indien und für die internationale politisch-gesellschaftliche Wetterlage zu erkennen ist bitter notwendig. Immer noch sieht man Indien einseitig als "größte Demokratie der Welt", ohne vor der Unterwanderung seiner demokratischen Strukturen zu warnen. Hier können die Brandreden von Arundhati Roy zumindest als Weckruf dienen. Zwar steigt sie in die zeitgenössische Geschichte des Hindu-Nationalismus ein, doch dessen eigentlicher, in der Kolonialgeschichte wurzelnder Ursprung wird in keinem ihrer Essays ausgearbeitet. Dafür ist Roy zu plakativ im Ausdruck, zu versessen auf rasche Urteile; sie schießt emphatische Leuchtkugeln ab, die aber grell immer nur die eine Seite der Situation zeigen. Die rhetorisch brillante Arundhati Roy macht sich leider gerade dessen schuldig, was sie den Politikern vorwirft, nämlich einer demagogisch gefärbten Sprache und Verurteilung.
Dass die Hindu-Gesellschaft auch eine konstruktive, vom Nationalismus freie Rolle im Weltgeschehen spielen könnte, trotz struktureller Schwächen wie dem Kastenwesen, bleibt von vorneherein ausgeschlossen. Mahatma Gandhi ist für die Autorin ein rotes Tuch, vor allem weil er zu Beginn seiner politischen Laufbahn den Kasten einen - eingeschränkten - Wert zugemessen hatte. Roy hält es stattdessen mit dem Freiheitskämpfer und Sozialreformer R. B. Ambedkar, einem bedeutenden Gegenspieler des Mahatma, der sich für die Rechte der niederen Kasten und Stämme einsetzte, sich zuletzt vom Hinduismus lossagte und Buddhist wurde. Ihn ausführlich in unsere Diskurse einzubringen wäre tatsächlich ein wichtiges Anliegen.
Die Essays lassen sich bis in Einzelheiten auf die aktuelle nationale Politik ein, weshalb es wichtig gewesen wäre, die politische Entwicklung seit 2021 bis zum heutigen Zeitpunkt fortzuschreiben, etwa in einem Nachwort. Auch irritieren die vielen Wiederholungen, die entstanden sind, weil Roys Reden vor unterschiedlichen Zuhörerkreisen ähnliche Themen behandeln. MARTIN KÄMPCHEN
Arundhati Roy:
"Azadi heißt Freiheit". Essays.
Aus dem Englischen von Jan Wilm. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2021. 254 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main