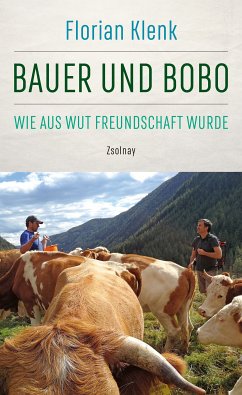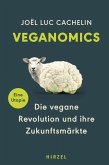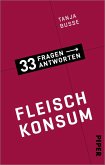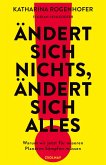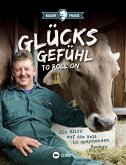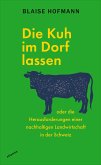Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Bank gegen Bauer: Florian Klenk erzählt von einem Landwirt, den die Agrarindustrie an den Rand des Ruins trieb.
Von Kai Spanke
Im Sommer 2014 spaziert eine deutsche Touristin durchs Tiroler Pinnistal. Sie befindet sich auf einem öffentlichen Weg und hat ihren Hund an der Leine. Daneben weiden Kühe, die, wenn sie Nachwuchs haben, auf Störungen jeder Art gereizt reagieren. Ein Bauer hat deswegen Schilder am Wegesrand angebracht, auf denen er vor seinen Tieren warnt: "Achtung Weidevieh! Halten Sie unbedingt Distanz! Mutterkühe schützen ihre Kälber. Betreten und Mitführen von Hunden nur auf eigene Gefahr!" Bei den Kühen handelt es sich um Tiroler Grauvieh. Niedlich, aber aggressiv. Ein Exemplar sieht in der deutschen Touristin eine Bedrohung, genauer: in deren Hund. Die Kuh rennt auf die Frau los und trampelt sie zu Tode.
Heute sind Weg und Weide durch einen Elektrozaun voneinander getrennt. Warum war das nicht damals schon so? Angriffe gab es schließlich häufiger. Anderthalb Wochen vor dem tödlichen Unglück kreisten rempelnde Kühe eine Familie ein. Dann wieder wurde eine Italienerin von einer Kuh auf die Hörner genommen - ihr Rucksack rettete ihr das Leben. Später wird der Richter festhalten, der Bauer habe gewusst, wie empfindlich seine Kühe seien; zudem habe er, der Bauer, regelmäßig die Wanderer und Radfahrer auf der Alm beobachtet. Deswegen hafte er für die Begräbniskosten, für das Trauerschmerzensgeld und für eine Rente, die dem Ehemann und dem Kind zustünden.
Florian Klenk, Jurist und Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Der Falter, der von dem Fall in seinem Buch "Bauer und Bobo" berichtet, ist sich sicher: "Schuld ist der Bauer." Fünf Jahre nach dem Tod der Deutschen kritisiert er in einer österreichischen Talkshow die Bauernlobbyisten - und erntet dafür einen Shitstorm. Denn Christian Bachler, ein sechsunddreißigjähriger Landwirt aus der Steiermark, macht seinem Ärger in einem Video auf Facebook medienwirksam Luft. Ahnungslos sei dieser Journalist, ein piekfeiner Bobo halt, also ein Bourgeois-Bohemian, der keinen Schimmer von den Sorgen der Bauern habe. Klenk solle mal ein Praktikum auf der Alm absolvieren, dann würde er schon sehen, wie die Dinge dort laufen.
Der wiederum reagiert nicht beleidigt, sondern nimmt das Angebot an. Die Männer kommen ins Gespräch. Über den Klimawandel und chinesische Touristen, EU-Fördergeber und die Wirtschaftskrise, Behördenschikanen und Milchpreise. In den vergangenen zwanzig Jahren sei ein Drittel der Bauern aus seiner Gegend weggezogen, sagt Bachler, wegen der verdorrten Wiesen, des teuren Futters, der europäischen Agrarpolitik. Ein strukturelles Problem, keine Einzelschicksale. Schon nach wenigen Stunden erkennt Klenk, dass es nicht die "Entschädigung an die Kuhopfer" ist, die Bachler beschäftigt, sondern der Untergang seines Standes.
Mit der teilnehmenden Beobachtung konkretisieren sich für den Praktikanten Zusammenhänge, die kaum jemand kennt. Die Erderwärmung beispielsweise dringt in Form des Leberegels in die Körper der Rinder ein. Der Parasit lebt in der Zwergschlammschnecke, die dank der Wärme immer höher auf die Alm wandert und in Pfützen lebt. Stillen die Rinder dort ihren Durst, infizieren sie sich. Also schüttet man Closamectin auf deren Rücken. Sie nehmen das Medikament über die Haut auf und scheiden Teile davon mit den Kuhfladen wieder aus. Jeder Mistkäfer, der davon kostet, stirbt sofort, und so bleibt der Dung bis zu zwei Jahre lang unzersetzt liegen.
Klenk befindet sich oft in der Rolle des staunenden Schülers, dessen Vater selbst auf einem Hof groß geworden ist. Er schreibt sachliche Passagen, auf die milde Polemik folgt, beschwört eine kitschige Landleben-Folklore, nur um sie gleich als erledigte Schwärmerei auszuflaggen. Die Niederschrift eines Rezepts scheint für ihn die Wahrscheinlichkeit einer Blamage nicht zu erhöhen, obwohl er sich damit in den Bereich des magazinhaften Retro-Lifestyles verirrt. Er mischt, kurzum, Argumentationsstile und Register, wie es ihm gerade passt. Hier Bekenntnis, dort Abhandlung und dann sogar noch ein Interview mit dem eigenen Vater.
Das muss nicht schlecht sein, solange man bei der Lektüre im Hinterkopf behält, dass der Journalist in diesem Buch keinen nüchternen Journalismus betreibt. Er hat ein Anliegen und erzählt gerne noch einmal, was andernorts schon zigfach ausgebreitet wurde, etwa dass in der Massentierhaltung katastrophale Zustände herrschen. Seine wichtigsten Verbündeten sind Zahlen. Beim Gastrogroßhändler Transgourmet kostet das Kilo Rinderfilet aus Deutschland 16,66 Euro. Schwein ist noch günstiger, 6,66 Euro. Da kann ein Landwirt wie Bachler, dem das Wohl seiner Tiere wichtig ist, nicht mithalten. Er füttert 26 Kühe und sechzig Schweine durch und lebt von achthundert Euro im Monat.
Gleichwohl ist Bachlers Leben kein Sonderfall. Vielmehr verleiten seine Probleme den Autor dazu, die Systemfrage zu stellen und das Duell mit drei Worten auf den Punkt zu bringen: "Bank gegen Bauer". Und immer gewinnt die Bank. Als Bachler wegen der Zwänge der Agrarindustrie und EU-Auflagen auf einem kaum noch zu tilgenden Schuldenberg hockt und seinen Besitz zu verlieren droht, wird aus dem Chefredakteur Florian Klenk ein Aktivist. Er organisiert auf verschlungenen Wegen eine Online-Spendenaktion, an deren Ende ein filmreifes Happy End steht. Hof gerettet, Bauer gerettet. 12 829 Menschen nehmen teil, 416 811,25 Euro kommen zusammen. Das wiederum ist sehr wohl ein Sonderfall und vermutlich der Grund, warum aus dieser langen Geschichte ein kurzweiliges Buch wurde.
Florian Klenk: "Bauer und Bobo". Wie aus Wut Freundschaft wurde.
Zsolnay Verlag, Wien 2021. 160 S., Abb., geb., 20,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main