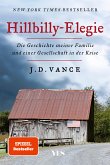In diesem Buch erzählt sie nun erstmals ihre Geschichte - in ihren eigenen Worten und auf ihre ganz eigene Art. Sie nimmt uns mit in ihre Welt und berichtet von all den Erfahrungen, die sie zu der starken Frau gemacht haben, die sie heute ist. Warmherzig, weise und unverblümt erzählt sie von ihrer Kindheit an der Chicagoer South Side, von den Jahren als Anwältin und leitende Angestellte, von der nicht immer einfachen Zeit als berufstätige Mutter sowie von ihrem Leben an Baracks Seite und dem Leben ihrer Familie im Weißen Haus. Gnadenlos ehrlich und voller Esprit schreibt sie sowohl über große Erfolge als auch über bittere Enttäuschungen, den privaten wie den öffentlichen. Dieses Buch ist mehr als eine Autobiografie. Es enthält die ungewöhnlich intimen Erinnerungen einer Frau mit Herz und Substanz, deren Geschichte uns zeigt, wie wichtig es ist, seiner eigenen Stimme zu folgen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Ständig betrat sie Räume, in denen alle anders aussahen als sie selbst. Aber das hat Michelle Obama nicht entmutigt, sondern bestärkt: Über "Becoming", ihre Memoiren
Sie war die Erste. Das gehört zwar zur Stellenbeschreibung einer First Lady, aber im Fall von Michelle Obama, die zwischen 2009 und 2017 mit ihrem Mann, den beiden Töchtern und einer wachsenden Zahl von Hunden im Weißen Haus in Washington, D. C. residiert hat, bedeutet es weit mehr. Es hat historisches Ausmaß: Michelle Obama aus Chicago war die erste schwarze First Lady in der amerikanischen Geschichte. Und sie wird es für immer bleiben.
Was das bedeutet und mit sich gebracht hat, beschreibt Michelle Obama jetzt in ihrer Autobiographie, die "Becoming" heißt; zu Deutsch eine Mischung zwischen "Werden" und "Wachsen". Das Buch erzählt die Geschichte einer Selbstverständlichkeit, die überhaupt nicht selbstverständlich ist und wohl auch niemals werden wird: dass ein Schwarzer zum amerikanischen Präsidenten gewählt werden kann und seine schwarze Familie damit das Land repräsentiert.
Die Möbel der Obamas standen noch nicht mal im Weißen Haus, da hatte der Widerstand gegen den schwarzen Präsidenten schon begonnen. Und er war nicht nur ideologisch motiviert, das ging tiefer, an die Essenz. Die Republikanische Partei war nicht nur fest entschlossen, den neuen demokratischen Präsidenten scheitern zu lassen, wo sie nur konnte: Sie wollte sich das Land zurückholen. "Let's take our country back", das war der Schlachtruf des konservativen, weißen Widerstands. Barack Obama, so die Vorstellung dahinter, mag zwar demokratisch gewählt worden sein. Aber seine Herrschaft ist illegitim, denn das Land gehört uns, nicht denen, die jetzt Obama bejubeln. Deswegen holen wir es uns zurück von diesem Schwarzen, der vielleicht noch nicht mal hier geboren wurde und vielleicht sogar ein Muslim ist, und seiner wütenden, schwarzen Frau, die alle Weißen hasst. Und Amerika überhaupt.
Michelle Obama erzählt in "Becoming" auch davon: von dieser gnadenlosen Verweigerung jeglichen Wohlwollens. Von den rassistischen Verletzungen und Demütigungen, von den Verleumdungen, denen insbesondere sie immer wieder ausgesetzt gewesen ist.
Aber "Becoming" ist ihr Buch, nicht das ihres Mannes (der an seinem gerade auch schreibt). Und auch wenn Michelle Obama Anlass genug dazu hätte, ist ihre Autobiographie keine Abrechnung, weder Anklage noch Verteidigungsschrift. "Becoming" ist auch kein politisches Buch, jedenfalls nicht im Sinne einer Partei oder eines Programms: Zum Schluss stellt Michelle Obama dann auch klar, dass sie niemals für ein politisches Amt kandidieren wird - und nimmt damit all jenen die Hoffnung, die schon eine Präsidentschaftskampagne für "Michelle 2020" gegründet haben.
Nein, was sich hier über fünfhundertfünfzig eng bedruckte Seiten erstreckt, ist vielmehr eine amerikanische Chronik, ein Familienroman, eine Romanze - aber vor allem die Geschichte einer Frau, die überall dort, wo sie hinkommt, die Erste ist, nicht nur als Schwarze, sondern auch als Frau und vor allem: als schwarze Frau. Man sieht diese Vereinigten Staaten von Amerika, die auf das Selbstverständnis bauen, dass hier jeder und jede alles werden kann, mit den Augen einer schwarzen Frau - die, je älter sie wird und je weiter sie kommt, erkennt, dass dieses Selbstverständnis für den einen Teil der Nation selbstverständlich ist, für den anderen aber immer wieder neu erkämpft werden muss.
Im Februar 2009 beispielsweise hält der neue Präsident Obama seine erste Rede vor dem Kongress, also Repräsentantenhaus und Senat, und auch sein Kabinett, der Generalstab, die Richter des Supreme Court sind da - das komplette politische Establishment in einem Saal. Michelle Obama schaut vom Rang auf sie alle hinunter. "Aus meiner ungewöhnlichen Vogelperspektive sah ich die Menschen, die für unser Land verantwortlich waren", erinnert sie sich, "ein Meer aus weißen Männern in dunklen Anzügen. Für ein modernes, multikulturelles Land war dieser Mangel an Vielfalt schon auffällig, wenn nicht sogar hochgradig peinlich. Bei den Republikanern stach das besonders ins Auge. Zu diesem Zeitpunkt saßen im Kongress genau sieben nicht-weiße Republikaner - darunter kein einziger Afroamerikaner - und nur eine Frau. Tatsächlich bestand der Kongress zu über achtzig Prozent aus männlichen Abgeordneten."
Damals, nach der Wahl 2008, gab es Stimmen, die in der Euphorie des Augenblicks erklärten, die Vereinigten Staaten hätten das Zeitalter der Rassentrennung hinter sich gelassen. Michelle Obama sah von dort oben, im Rang, auf einen Blick, wie weit ihr Land davon noch entfernt war. Andersherum war ihr Anblick, Michelle Obama über diesem Meer weißer Männer, für Millionen schwarzer Amerikanerinnen ein Triumph. (Und für alle anderen, die keine weißen amerikanischen Männer sind, auch.)
"Jede schwarze Frau auf dem Titel eines großen Magazins zählt", schreibt Michelle Obama über den Moment, als die "Vogue" sie zum Coverstar machen will und sie mit ihrem Stab darüber debattiert, wie das wirken würde. Und diese Sichtbarkeit der Minderheit ist in einer Demokratie, die auf Repräsentation angelegt ist, essentiell, nicht nur im politischen Raum. Kurz nach der Rede im Kongress vor dem Meer weißer Männer gehen die Obamas auf ihre erste Auslandsreise, zum G-20-Gipfel in London. Im Buckingham Palace umarmt Michelle Obama die Queen, was ein kleiner Skandal wird, weil man so was nicht tut, am Tag danach besucht sie eine ausgezeichnete staatliche Mädchenschule im sozial schwachen Islington: neunhundert Schülerinnen, neunzig Prozent schwarz oder Angehörige einer Minderheit.
Die Mädchen führen Shakespeare für die First Lady auf, ein Chor singt Whitney Houston - und Michelle Obama kommt es plötzlich so vor, als sitze sie in einer Zeitmaschine und schaute sich selbst zu: "Ein Blick in die Gesichter der Mädchen reichte aus, um zu wissen, dass sie sich trotz ihrer Stärken extrem würden anstrengen müssen, um überhaupt wahrgenommen zu werden", schreibt sie. "Sie würden gegen die Unsichtbarkeit ankämpfen müssen, die mit den Merkmalen ,arm', ,weiblich' und ,andere Hautfarbe' einhergingen."
Michelle LaVaughn Robinson, Jahrgang 1964, wächst im Süden von Chicago auf - einer Stadt, die für den derzeitigen Präsidenten Trump so etwas wie das Babylon schwarzer Bandenkriminalität ist, geduldet von korrupten demokratischen Politikern. Michelles Vater arbeitet bei den Wasserwerken, die Mutter als Sekretärin, in ihrem bescheidenen, gepflegten Haus lebt Michelles Tante, die bald auch ihrer Nichte Klavierunterricht gibt. Zur Highschool fährt Michelle im Bus auf die andere Seite Chicagos, anderthalb Stunden hin, anderthalb zurück. Die Schule ist als integratives Projekt angelegt, aber die Weißen haben nicht mitgemacht, also gehören achtzig Prozent der Schülerinnen und Schüler einer Minderheit an. Michelle ist begabt, sie ist ehrgeizig, sie ist rastlos, sie liebt Stevie Wonder und will an einer Ivy-League-Uni studieren, in Princeton, wie ihr Bruder Craig, ein Basketball-Star. Du bist für Princeton nicht gemacht, sagt die Studienberaterin - aber Princeton nimmt sie auf.
Dort, unter weißen Studenten, verändert sich Michelle Robinson: An der Highschool hatte ich für mein Viertel gestanden, schreibt sie, in Princeton für meine Rasse. Immer wieder betritt sie Räume, in denen sie die Einzige ist, die so aussieht wie sie, spürt, dass sie zwar geduldet ist, aber die Ruhe stört. "Wir Angehörige von Minderheiten waren in Princeton so wenige, dass unsere Anwesenheit wohl immer auffiel. Ich fasste das hauptsächlich als Auftrag zu Höchstleistungen auf." Sie schließt das College in Soziologie ab. Wechselt an die Harvard Law School. "Bin ich gut genug?", fragt sie sich immer wieder. "Ja, das bin ich wirklich." Sie kehrt nach dem Examen nach Chicago zurück. In ihrer Anwaltskanzlei betreut sie Praktikanten von den Elite-Unis, die ihre Semesterferien zum Kontakteknüpfen nutzen. Im Sommer 1989 kommt da einer aus Harvard in ihre Kanzlei, dem ein irrer Ruf vorauseilt, ein Wunderkind, der beste Student, der hier je aufgetaucht ist. "Ich blieb skeptisch", schreibt sie. "Meiner Erfahrung nach brauchte man irgendeinen halbwegs intelligenten schwarzen Mann nur in einen Anzug zu stecken, und schon flippten die Weißen aus." Drei Jahre später heiratet sie Barack Hussein Obama.
Er ist der Sohn einer weißen Akademikerin aus dem Mittleren Westen und eines Kenianers; nachdem die Eltern sich getrennt haben, wächst er kurz in Indonesien und später dann in Hawaii bei seinen weißen Großeltern auf. Sie kommt aus einer schwarzen amerikanischen Mittelschichtsfamilie. Ihr Onkel Robbie war Nachtzugportier, "ein angesehener, wenn auch nicht sehr gut bezahlter Beruf, der nur von schwarzen Männern ausgeübt wurde", den Rasen vor dem Haus der Großfamilie in der Euclid Avenue mähte der Onkel auch in der größten Hitze mit Hosenträgern, Schnürschuhen und Hut. Der Großvater ihres Großvaters mütterlicherseits war ein Sklave aus Georgia gewesen und in den zwanziger Jahren nach Norden gezogen - wie so viele andere Schwarze dieser Generation aus dem Süden. Die Stimme ihres Vaters, der schwerkrank mit Mitte fünfzig stirbt, beschreibt sie als "nur gute Laune, Sanftheit und eine winzige Spur Jazz". Jazz ist die Melodie dieser Familie, dieses Lebens. Jazz und Stevie Wonder (der Michelle Obama im Wahlkampf 2008, ohne, dass die beiden sich kennen, eine solidarische SMS schickt, was sie natürlich umhaut).
Als Barack Obama Mitte der neunziger Jahre in die Politik geht, mit Michelle an seiner Seite, die inzwischen im Rathaus von Chicago arbeitet, bekommen die beiden aber aus der schwarzen Community zu hören, er sei nicht schwarz genug. Diese Kritik begleitet Barack Obama bis heute, jener Vorwurf, er habe seine Leute im Stich gelassen und seine beiden Amtszeiten nicht genutzt, habe sich in Kompromissen mit der anderen Seite verzettelt. Barack Obama aber war von Anfang an damit angetreten, der Präsident der gesamten Vereinigten Staaten zu sein, nicht einzelner Teile. Dass Michelle Obama wiederum in diesem Buch wie in all den Jahren im Weißen Haus die schwarze Tradition beschwört, aus der sie kommt, und ihre eigenen Erfahrungen als Angehörige einer Minderheit zur Sprache bringt, wo sie nur kann, ist kein Widerspruch dazu. Im Gegenteil: Es ist das Fundament dieser Haltung, der Garant des sozialen Friedens.
Der Journalist Ta-Nehisi Coates hat das einmal exzellent auf den Punkt gebracht: "Wenn man die schwarze Identität analog zur Südstaaten-Identität oder zur irischen oder italienischen Identität versteht - nicht als separaten Stamm, sondern als einen Ast am amerikanischen Baum, der in einer umfassenderen Erfahrung wurzelt -, dann versteht man, dass die Besonderheiten der schwarzen Identität nicht von den Besonderheiten des Landes zu trennen sind", schreibt er in seinem letzten Buch, einer Sammlung von Reportagen aus den acht Obama-Jahren. "Ein Freund von mir hat mal gesagt, Michelle ,macht Barack schwarz', aber das trifft es nicht. Sie macht Barack nicht einfach schwarz - sie macht ihn zum Amerikaner."
Michelle Obama, die Amerikanerin: "Becoming" ist das Zeugnis einer kompromisslosen Haltung - und warum sollte sie auch Kompromisse machen, sie ist doch Amerikanerin. Selbstverständlich lässt sie sich von niemandem einreden, dass es nicht selbstverständlich sei, dass sie dort angekommen ist, wo sie heute ist, und dass dieser Weg jeder Amerikanerin und jedem Amerikaner, gleich jeder Herkunft, zusteht. Da komme ich her, dort will hin ich, so bin ich auf dem Weg, bis ich angekommen bin. Das bin ich - deal with it. Die Rollen, die Michelle Obama dabei spielt - die erfolgreiche Anwältin, die Mutter zweier Töchter, die Frau eines Politikers, die schwarze Frau eines schwarzen Politikers - verrechnet sie nicht gegeneinander. Sie rechtfertigt sich nicht. Dass sie sich im ersten Präsidentschaftswahlkampf 2008 darum sorgt, wie ihre kleinen Mädchen angezogen sind ("Es dauerte nicht lange, bis ich mir weniger Gedanken darüber machte, ob Sasha und Malia aussahen wie die Töchter eines zukünftigen Präsidenten, als darum, ob sie wenigstens aussahen, als hätten sie eine Mutter."), nimmt ihren politischen Anliegen (Bildungsgerechtigkeit, gesunde Ernährung, Fitness) nichts an Ernst. Sie lässt sich nichts vorschreiben - wie Hillary Clinton, die als First Lady noch öffentlich Plätzchen backen musste, eine Demütigung und Unverschämtheit, an der Clinton bis heute knabbert. Michelle Obama hat einen Gemüsegarten im Weißen Haus angelegt.
Am Tag, als die Obamas dort einziehen, 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, D. C., führt Laura Bush sie durch ihr neues Zuhause, während George und Barack den Fitnessraum inspizieren. Wie fühlen Sie sich, fragt Laura Bush. Ein bisschen überwältigt, sagt Michelle. Ich weiß, antwortet Laura, das können Sie mir glauben. "Später habe ich oft an das Gespräch zurückgedacht. Barack und ich wurden Teil einer Gemeinschaft, die lediglich aus den Clintons, den Carters, den beiden Ehepaaren Bush sowie Nancy Reagan und Betty Ford bestand", schreibt Michelle Obama jetzt. "So unterschiedlich wir auch sind, diese Erfahrung wird uns für immer miteinander verbinden." Das Gespür für Repräsentation, für das Amt und die Aufgabe, die nur für kurze Dauer verliehen sind, aber über diese Dauer hinaus Wirkung zeigen, das Verantwortungsgefühl und die Demut, die damit einhergeht: Diese kurze Passage in "Becoming" macht es noch schwerer, im Augenblick auf das Weiße Haus und seine Bewohner zu schauen. Zehn Jahre, nachdem dort der erste schwarze Mann und die erste schwarze Frau mit ihren schwarzen Kindern einzogen, um alle Amerikanerinnen und Amerikaner zu repräsentieren, gleich welcher Hautfarbe.
TOBIAS RÜTHER
Michelle Obama: "Becoming. Meine Geschichte". Übersetzt von Hariett Fricke, Tanja Handels, Elke Link, Andrea O'Brien, Jan Schönherr und Henriette Zeltner. Goldmann-Verlag, 544 Seiten, 26 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main