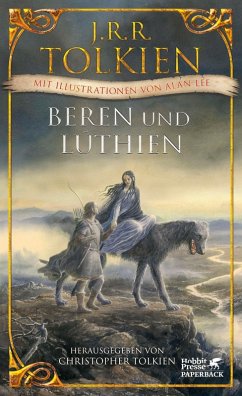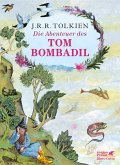Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Diese Orks sind schon so fies wie im "Herrn der Ringe": Christopher Tolkien versammelt die "Beren und Lúthien"-Dichtungen seines Vaters
Wenn die Not groß ist, wenn der Feind irgendwo da draußen lauert, aber noch keine Anstalten macht, sich zu zeigen, wenn das Warten allzu zermürbend ist, dann schadet Ablenkung nicht. Der Waldläufer Aragorn jedenfalls, der mit seinen Reisegefährten, den Hobbits, auf einem Bergvorsprung namens Wetterspitze rastet, singt für sie ein altes Lied, das in einer Reihe von Varianten in ganz Mittelerde verbreitet ist. Es handelt von den Liebenden Beren und Lúthien, einem Menschen und einer Elbenfrau, und dass Aragorn darin seiner eigenen hoffnungslosen Liebe zur Elbin Arwen gedenkt, können die arglosen Hobbits nicht wissen.
Bekanntlich fußt J. R. R. Tolkiens großer Roman "Der Herr der Ringe" auf einer Privatmythologie, die er in lebenslanger Schreibseligkeit entwickelte, zum allergrößten Teil nie publizierte und die trotzdem in Form von Anspielungen oder Zusammenfassungen Eingang in sein veröffentlichtes Werk fand. Nach seinem Tod übernahm es sein 1924 geborener Sohn Christopher Tolkien, den Nachlass zu sichten und wiederum in Teilen herauszugeben - was das für eine Arbeit bedeutet, wie disparat das verstreute Material auf zum Teil mehrfach beschriebenen Zetteln mit seinen vielfach korrigierten Fragmenten ist, lassen Stoßseufzer des Editors erahnen, die sich in den Vorworten zu der inzwischen stattlichen Reihe von posthumen Tolkien-Bänden finden. Die meisten von ihnen enthalten tatsächlich Texte, die den Hintergrund zu den im "Herrn der Ringe" geschilderten Ereignissen aufhellen, meist im sogenannten Ersten Zeitalter angesiedelt: Da sind die Wanderungen diverser Elbenvölker, die sich in den Wäldern Mittelerdes verlieren oder den Weg übers Meer einschlagen und dann in geringerer Zahl wieder zurückkehren, da sind die magischen Steine, die Silmarilli, um deren Besitz Elben untereinander und mit dem bösen Melko (oder Morgoth) streiten, und da sind Menschen, die in tragischer Verstrickung untergehen, wobei Tolkien ganz offensichtlich die "Kullervo"Episode aus dem finnischen Nationalepos "Kalevala" zum Ausgangspunkt seiner eigenen Dichtung machte.
Ein wesentlicher Erzählstrang unter diesen Geschichten, die J. R. R. Tolkien selbst zu Zyklen zusammenstellte oder dies wenigstens beabsichtigte und die Christopher Tolkien dann unter Titeln wie "Die Geschichte von Mittelerde" oder "Das Silmarillion" bearbeitete und herausgab, ist eben die von Beren und Lúthien. Dieser Tage erscheinen die Textzeugnisse dazu in Auswahl in einem eigenen Band, und der mittlerweile 92 Jahre alte Herausgeber beschreibt in seinem Vorwort den Zweck dieser Ausgabe, die sämtlich bereits bekannte Texte bündele, im Bemühen, gerade die Metamorphose dieses Stoffs unter der Hand seines Vaters anschaulich zu machen. Das jedenfalls gelingt, zudem erscheinen wesentliche Elemente des Beren-Mythos hier erstmals auf Deutsch. Die Frage ist allerdings, ob diese Erweiterung der Textgrundlage in literarischer Hinsicht ein Gewinn ist.
Die Stoffgeschichte von "Beren und Lúthien" reicht bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs zurück, als der jung verheiratete Autor, angeregt offenbar durch die Beobachtung seiner in einem Wäldchen tanzenden Frau Edith, eine analoge Szene der ersten Begegnung zwischen dem im Wald herumstreifenden Elben Beren und der Elbin Tinúviel (die spätere Lúthien) entwarf. Die allererste Fassung ist allerdings verloren: Tolkien hat sie ausradiert und bald darauf mit einer neuen Version überschrieben, die sich erhalten hat und den Auftakt zur jetzt vorgelegten Publikation bildet. Sie ist bekannt - eine längere Fassung von ihr findet sich im "Buch der verschollenen Geschichten", das Christopher Tolkien bereits 1983 vorgelegt hatte, zehn Jahre nach dem Tod seines Vaters. In der ersten erhaltenen Fassung der Liebesgeschichte aber ist Beren noch kein Mensch, sondern Elbe, wenn auch der Hass zwischen den Stämmen kräftig ausgemalt wird, um den Abstand zwischen den beiden zu betonen, die später ein Paar werden sollen: "Furcht und Argwohn" herrschen zwischen den Völkern, und so stößt Beren bei Tinúviels Vater auf taube Ohren, als er um ihre Hand anhält: Er müsse ihm schon einen Silmaril von Melkos Krone bringen, sonst werde das mit der Hochzeit nichts, sagt der Vater feixend.
Tolkien zitiert hier ein uraltes Märchenmotiv: Um das Mädchen zu erringen, erhält der Junge eine unlösbare Aufgabe und macht sich trotzdem auf den Weg. Dazu kommt allerdings einiges von dem, was später Tolkiens Werk prägen sollte. Da sind etwa schon die Orks, "widerwärtige Ausgeburten Melkos, immer unterwegs, Melkos schmutzige Arbeit zu verrichten, Tieren, Elben und Menschen nachstellend, die sie packten und vor ihren Herrn schleppten". Da sind suggestive Schilderungen aus je eigenen kleinen Welten wie die aus dem Palast von Tevildo, dem Fürsten der Katzen: "Diese Hallen waren kaum erleuchtet, sondern erfüllt von Knurren und ohrenbetäubendem Schnurren. Katzenaugen leuchteten überall, wie rote, grüne oder gelbe Lampen glühend, wo die Katzen aus Tevildos Gefolge saßen und mit ihren prachtvollen Schwänzen schlugen oder peitschten; Tevildo selbst thronte über ihnen, eine riesige Katze, pechschwarz und bösartig anzuschauen." Und da sind Sätze, schlicht und gediegen, die ihr Autor direkt aus dem Märchenkosmos zu beziehen scheint, aber auf die ihm eigene Art umformt, etwa wenn Tinúviel von Berens Gefangenschaft erfährt und ruhig verkündet: "Dann muss ich gehen und ihm beistehen, denn ich kenne sonst niemanden, der das tun wird."
Eine der beeindruckendsten Szenen ist, wie sich Tinúviel selbst zu einer Art Rapunzel macht, indem sie ihr Haar mit einem Zauber belegt und fortan allen Segen, der auf ihrer gefährlichen Reise liegt, eben daraus bezieht. Mit Hilfe eines treuen, wild lebenden Hundes befreit sie Beren aus der Gefangenschaft der Katzen, dringt in Melkos Halle ein, tanzt ihn in den Schlaf, flieht gemeinsam mit Beren und einem gestohlenen Silmaril und muss am Ende erleben, wie ihr Geliebter im Kampf gegen einen tollwütigen Wachwolf, der Berens Hand mitsamt dem Silmaril verschlungen hatte, stirbt. Das Ende? Nein, so wird nun eine Variante der Geschichte zitiert, Tinúviel habe den Liebsten vom Totenherrscher erbeten, und der habe sich erweichen lassen.
Damit könnte es sein Bewenden haben, aber Christopher Tolkien zeigt nun in einer Reihe von weiteren Textzeugnissen die Wandlungen des Stoffes an: Namen verändern sich, die Katzen verschwinden, eine Art Proto-Sauron erscheint, andere Elbenherrscher kommen hinzu, und die Liebenden haben Nachkommen wie Elrond, der im "Herrn der Ringe" als Gastgeber der gegen Sauron Verschworenen fungiert. Der Stoff wird komplizierter, seine Formen werden es auch, etwa indem Tolkien ihn als Langgedicht darbietet.
Und das klingt dann so: "Sich selbst verfluchend hauchte graus / Gorlim zuletzt die Seele aus. / Barahir ward beraubt des Lebens, / alle Tapferkeit war vergebens. / Doch Morgoths arger Plan misslang, / die Feinde er nie ganz bezwang, / manche blieben im Widerstand / und lösten auf, was Bosheit band." Dass Tolkien als Lyriker, gerade auch wenn es um das Nachdichten tradierter Formen geht, Beachtliches leisten konnte, zeigen andere Nachlassdichtungen durchaus. Das Lied von Beren und Lúthien aber ist kein Ruhmesblatt, und so interessant der Vergleich mit der früheren Fassung in philologischer Hinsicht ist, so unbefriedigend ist er in ästhetischer.
Aufschlussreich ist immerhin, wie intensiv Tolkien auch noch in der Folge mit dem Stoff beschäftigt war, wozu sein Sohn und Nachlassverwalter eine Reihe von wiederum Prosafassungen anführt. Die Arbeit am "Herrn der Ringe" allerdings überlagerte dann alles. Es scheint so, als wäre das Entstehen des Romans mit dem Verlust weiterer "Beren und Lúthien"-Dichtungen nicht zu teuer bezahlt. Tolkien aber setzte auf den gemeinsamen Grabstein unter den Namen seiner Frau das Wort "Luthien". Und unter den eigenen Namen: "Beren".
TILMAN SPRECKELSEN
J. R. R. Tolkien: "Beren und Lúthien".
Hrsg. von Christopher Tolkien. Bilder von Alan Lee. Aus dem Englischen von Hans-Ulrich Möhring und Helmut W. Pesch. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2017. 304 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main