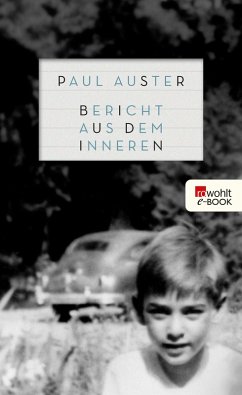Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
"Er versetzt immer wieder in Erstaunen, dieser Paul Auster." -- Welt am Sonntag
"Paul Auster versteht es meisterhaft, seine Leser zu fesseln." -- Der Tagesspiegel

Was ist mit Paul Auster los? In seinem neuen Buch "Bericht aus dem Inneren" macht er sich selbst zum Gegenstand. Ist das aber so interessant, wie er glaubt?
Von Julia Encke
Die Romane des amerikanischen Schriftstellers Paul Auster folgen immer demselben Muster: Ein Protagonist, meistens ein Mann, oft Schriftsteller oder Intellektueller, lebt wie ein Mönch, hat einen schrecklichen Verlust erlitten. Immer herrscht B-Movie-Atmoshäre. Leute sagen Sachen wie: "Meine Muschi kann man nicht kaufen" oder "Du bist aber ein harter Hund, Alter". Dann wird elegant Chateaubriand, Rousseau, Poe oder Beckett zitiert, Doppelgänger und Alter Egos treten auf. Und am Ende stellt sich heraus, dass alles, was erzählt wurde, gar nicht wirklich passiert ist, sondern sich nur im Kopf des Helden abgespielt hat - meint James Wood, der berühmte Literaturkritiker der amerikanischen Zeitschrift "New Yorker".
Wood ist eigentlich gar nicht berühmt für seine Polemiken. Aber Austers Bücher sagen ihm nicht zu, er findet sie seicht und parodiert ihren Ton so böse, dass man schon beschließt, dem Autor zu Hilfe zu eilen und ihn zu verteidigen. Schließlich ist es Austers Ton, der diese besondere Verführungsmacht besitzt. Das kann ihm so leicht keiner nachmachen. Man schlägt den neuen Roman auf, "Bericht aus dem Inneren", und ist gleich wieder drin im Auster-Universum, diesmal mit einer Kindheitserinnerung: "Am Anfang war alles lebendig. Die kleinsten Gegenstände waren mit pochenden Herzen ausgestattet, und selbst die Wolken hatten Namen. Scheren konnten gehen, Telefone und Teekessel waren Cousins, Augen und Brillen waren Brüder. Die Äste der Bäume waren Arme. Steine konnten denken, und Gott war überall." So geht es weiter, bis man irgendwann merkt, zur Verteidigung bald kaum noch etwas vorbringen zu können: "Bericht aus dem Inneren" ist der wohl enttäuschendste Roman, den Auster je geschrieben hat.
Erst im vergangenen Jahr ist sein "Winterjournal" erschienen. Der Autor, der sich mit Mitte sechzig in den "Winter des Lebens" eintreten sah, erzählte darin seine eigene Geschichte als Körper-Chronik, als Protokoll von Sinnesdaten, ersten Küssen, Narben, Stürzen, Krankheiten, die er mit charmanten Listen anreicherte. Wie ein Buchhalter verzeichnete Auster die einundzwanzig Woh2nungen und Häuser, in denen er sein Leben bis dahin verbracht hatte, samt Adresse, Größe, Einrichtung und Mietkosten. Er gab an, mit welcher seiner Freundinnen er wo geschlafen hat, wieso das Licht wo durch welches Fenster fiel, was er wo schrieb. Und er sagte "du" zu sich selbst, verfasste das ganze Buch in dieser "Du"-Form, mit der er einen Abstand zu sich selbst schuf.
Auch jetzt, im "Bericht aus dem Inneren" verwendet er dieses "du", was auf eine Art Fortsetzung hindeutet: War das "Winterjournal" eine Körpererkundung, so ist das neue Buch eine der eigenen Bewusstwerdung, eine Durchforstung der Gedanken, die Auster aus seiner Kindheit in Erinnerung hat. "Die Welt ist in meinem Kopf. Mein Körper ist in der Welt", lautet das Paradox, das ihn anleitet. Nicht einmal die Behauptung, dass er sich erinnere, "nicht weil du ein rares und außergewöhnliches Untersuchungsobjekt zu sein glaubst, sondern ganz im Gegenteil, weil du dich für alltäglich hältst, für einen Menschen wie alle anderen", versteht man als Koketterie. Das Typische, Zeitgemäße am eigenen Leben herauszustellen, sich als Figur der Zeit in den Blick zu rücken könnte Ziel des Projekts sein.
Nur hört es bald gar nicht mehr auf, gewöhnlich zu sein, ohne dass dabei auch nur irgendetwas über die jeweilige Zeit gesagt würde: "Im Sommer: einen Grashalm der Länge nach spalten und darauf blasen; abends Glühwürmchen fangen und mit deinem magisch leuchtenden Glas umhergehen. Im Herbst: dir die geflügelten Früchte, die von den Ahornbäumen fielen, auf die Nase stecken; Eicheln vom Boden auflesen." Aha. "Langeweile darf als Quelle innerer Einkehr und Träumereien nicht außer Acht gelassen werden." Ja, klar. Oder später: "Die Ära der Pickel und Zahnspangen hatte begonnen. Zum Glück kommen diese Tage nur einmal."
Was nicht heißt, dass es nicht auch eindrucksvolle Erinnerungsschnipsel gäbe, einprägsame Anekdoten. An einer Stelle erzählt Auster von seinem frühen Idol, dem Erfinder Thomas Edison. Mit nicht einmal zehn Jahren las er als Junge die beiden Biographien, die es damals über Edison gab, guckte Filme über ihn und bildete sich viel darauf ein, dass Edison und er beide Anfang Februar Geburtstag hatten. Als sein Vater ihm überraschend offenbarte, dass er einmal in Edisons Labor gearbeitet hatte, wuchs Paul Austers Stolz ins Unermessliche. Die Zufriedenheit darüber, dass der Vater für ihn jetzt keine komplette Null mehr war, sondern jemand, der an dem Werk, die Welt zu verbessern, mitgearbeitet hatte, rettete alles. Erst Jahre später erzählte sein Vater ihm, dass sein Job bei Edison in Wahrheit nur ein paar Tage gedauert hatte. Der Erfinder hatte herausgefunden, dass er Jude war, und ihn gefeuert. Paul Austers Idol - ein fanatischer Antisemit. In den Büchern über ihn hatte das nicht gestanden.
Es sind solche Passagen, die einen mit der sonst so öde dahindämmernden Bewusstwerdungsstromerzählung sofort wieder versöhnen, die einen milde stimmen. Man käme nicht auf die Idee, das Buch einfach wegzulegen. Das wird im zweiten Teil anders. Denn der zweite Teil besteht aus einer Art Schulaufsatz, der brav und ohne Twist zwei Filme nacherzählt, die Auster in seiner Kindheit beeindruckt haben: "Die unglaubliche Geschichte des Mister C.", im amerikanischen Original "The Incredible Shrinking Man" von Jack Arnold, ein Film von 1957. Und "Jagd auf James A", "I Am a Fugitive from a Chain Gang" aus den dreißiger Jahren von Mervyn LeRoy. In der Beschreibung den Moment des ersten Sehens noch mal zu durchleben - darum scheint es hier zu gehen. Nur misslingt es völlig. Weder die Wucht des Erlebnisses noch irgendeine Form der Faszination vermittelt sich. Man ist einfach nur froh, wenn die Kapitel vorbei sind.
Grund zum Aufatmen gibt es aber nicht. Paul Auster kriegt Post von seiner ersten Ehefrau, der Schriftstellerin Lydia Davis, die, wie Literaten es häufig tun, ihre Papiere und Manuskripte einer Forschungsbibliothek zur Verfügung stellen will, darunter auch Briefe von Paul Auster. Er solle sich einige davon doch noch einmal ansehen und sein Einverständnis signalisieren, sagt sie und schickt ihm Kopien zu. Auster, der nach einem ersten Versuch mit achtzehn nie mehr Tagebuch geführt hat, freut sich. Diese Briefe seien seine eigentlichen Tagebücher, befindet er und hängt die Passagen, in denen er sich selbst besonders fremd erscheint ("dass es dir vorkam, als läsest du die Worte eines Fremden, so weit entfernt war dieser Mensch jetzt von dir") einfach an sein Buch dran, kommentiert ein bisschen herum. Fertig.
Betrogen fühlt man sich vor allem, weil man den Eindruck hat, der Autor gebe sich überhaupt keine Mühe mehr. Lose verbunden wird alles Mögliche aneinandergereiht, ohne dass sich erschließt, wieso. Warum noch mal muss man sich jetzt die stereotypen Stilisierungen des heranwachsenden Intellektuellen in Paris anhören ("Ich rauche ,Parisiennes'"; "Manchmal erschaudere ich bei dem Gedanken, dass ich von niemandem geliebt werden kann")? Warum geht der Autor überhaupt davon aus, dass alle Winkelzüge seiner Bewusstseinswerdung interessant sind? Der "Bericht aus dem Inneren" ist eine selbstgefällige, eine narzisstische Prosa. Paul Auster meint interessant zu sein, weil er Paul Auster ist. Doch stellt man dann fest, dass der einen am Ende leider nicht mehr besonders interessiert.
Paul Auster: "Bericht aus dem Inneren".
Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz. Rowohlt Verlag, Reinbek 2014. 360 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH