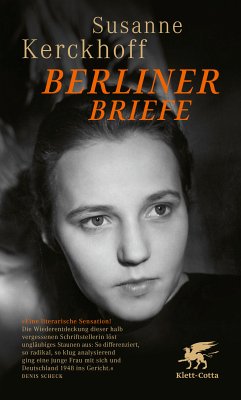Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Verdrängte Schuld und Grabenkämpfe: Mit ihren "Berliner Briefen" von 1948 ist Susanne Kerckhoff neu zu entdecken
Dieses Buch ist eine Enttäuschung in doppelter Hinsicht. Es düpiert alle diejenigen, die sich, etwa nach der lobenden Besprechung im "Literarischen Quartett", einen Schlüsselroman zur deutschen Nachkriegszeit erhofft haben. Zugleich enttäuscht es auch die entgegengesetzte, durch den Klappentext und das Umschlagbild genährte Erwartung auf eine autobiographische Tour de Force zu den seelischen Trümmerfeldern der "Stunde null". Man tut sich leichter zu sagen, was es nicht ist, als seinen besonderen Sound und Gestus zu beschreiben. Aber eben darin, in seinem Eigensinn, ist dieses Buch groß.
Die "Berliner Briefe" sind auf den ersten Blick genau das, was der Titel verspricht - eine Folge von dreizehn Briefen einer Berlinerin namens Helene an ihren jüdischen Freund Hans, der den Verfolgungen im Nationalsozialismus entkommen ist und nun in Paris lebt. Auf den zweiten Blick aber sieht man, dass dieser jüdisch-deutsche Hans trotz seiner mehrfach erwähnten Antwortbriefe nur ein Mundstück ist, in das die Erzählerin hineinbläst, damit ihr Ton die ganze Welt erreicht. Schon deshalb ist der Gattungsbegriff "Briefroman", den der Verlag auf den Umschlag gesetzt hat, irreführend. In diesen Briefen wird keine Handlung entfaltet, keine Liebes- oder Kriegsgeschichte abgespult. Hier spricht nur eine einzige Stimme: die der Absenderin Helene und, durch sie hindurch, die der Autorin. Doch das, was sie sagt, ist derart, dass man nicht aufhören kann, ihr zuzuhören. Es ist, als hätte man in einem Tonbandarchiv einen Monolog entdeckt, der vor gut siebzig Jahren aufgenommen wurde, mit allen Hintergrundgeräuschen jener Zeit, dem ideologischen Gezänk ebenso wie dem Dröhnen und Knistern des Alltags.
Susanne Kerckhoff, die Verfasserin der "Berliner Briefe", war fünfzehn Jahre alt, als die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen. Im "Dritten Reich" studierte sie Philosophie und machte als Autorin von Unterhaltungsromanen und jüngstes Mitglied der Reichsschrifttumskammer Karriere. Zugleich versteckte sie jüdische Kommilitonen im Keller ihres Elternhauses im Berliner Außenbezirk Karolinenhof. Nach Kriegsende trat sie mit ihrem Mann, dem Buchhändler Hermann Kerckhoff, in Hannover in die SPD ein. Dann aber verließ sie Kerckhoff, mit dem sie drei Kinder hatte, ging nach Ost-Berlin und wurde 1948 Mitglied der SED. Im gleichen Jahr erschienen die "Berliner Briefe" erstmals im Wedding-Verlag im französischen Sektor Berlins. Ein Jahr später wurde Susanne Kerckhoff Feuilletonredakteurin und kurz darauf Kulturchefin der "Berliner Zeitung". Im März 1950 nahm sie sich, von privatem Unglück und öffentlicher Hetze durch kommunistische Kulturfunktionäre zermürbt, das Leben.
Wie spiegelt sich nun diese Existenz, die von Widersprüchen und Unruhe, von Suchbewegungen und jähen Entscheidungen geprägt war, in den "Berliner Briefen"? Im ersten Brief schreibt Helene an Hans, sie fühle sich als "ein Teil des Trümmeratems von Berlin" - eine Symbolfigur der geteilten Stadt. Zugleich erklärt sie, sie spreche "für keine Gruppe, keine Partei, keine Kirche, keine Klasse, nicht einmal für meine Generation". In diesem Zwiespalt zwischen Selbstgespräch und Verkündertum schreitet das Buch voran, bis Helene hundert Seiten später resümiert, ihr sei zumute, "als hätte ich einen Felsblock den Berg hinaufgeschoben". Dieser Felsblock ist die deutsche Schuld.
Die Schuld am Krieg, an der Massenvernichtung der europäischen Juden, an der Zerstörung des eigenen Landes und anderer Länder - das ist ein Block, dessen Ausmaße drei Jahre nach Kriegsende schon sehr genau bekannt sind. Aber wie Sisyphos muss ihn die Erzählerin immer wieder neu bergauf wälzen, denn ihre Landsleute wollen von der eigenen Verstrickung nichts mehr wissen. "Wenn wir gesiegt hätten, dann wären Stalin und Churchill in Nürnberg aufgehängt worden!" Das hört Helene "in der Schlange vor dem Fleischerladen". Die "Profaschisten" sind überall, die "radikale Abrechnung" mit dem braunen Mob hat nicht stattgefunden. Aber auch an sich selbst entdeckt die Briefschreiberin den Makel des Mitläufertums: "Ich tastete mein charakterliches Rückgrat ab und fand es durchaus nicht so köstlich steif, wie ich es mir eingebildet hatte." Ihre Konsequenz ist, wenigstens im Gestischen, radikal: "Über Juden spricht man nicht, vor ihnen steht man auf."
Das ist die eine Seite dieses Monologs, der sich immer wieder zu modellhaften Szenen verdichtet wie jenem Klassentreffen im Nachkriegs-Berlin, bei dem die einstige BDM-Führerin und "ärgste Antisemitin" der Schule, inzwischen längst wieder "gut ernährt, lebensvoll, charmant", mit Anekdoten aus ihrer Dolmetschertätigkeit für die amerikanischen Besatzer glänzt. Die andere Seite ist die Schilderung der gerade entstehenden Parteienlandschaft mit ihren ideologischen Gräben, ihren scharfen Trennungen zwischen West und Ost. Dabei kriegt die West-SPD unter Führung Kurt Schumachers besonders heftig ihr Fett weg: "Die Sozialdemokratische Partei fischt im Trüben, ködert mit den Würmern einer russenfeindlichen Propaganda den Ressentiment-Deutschen." Der Zorn, der aus solchen Sätzen spricht, ist auch persönlich gefärbt. Susanne Kerckhoffs Ex-Mann blieb, anders als sie, Mitglied der SPD. Nach der Scheidung bekam er das Sorgerecht über die gemeinsamen Kinder zugesprochen. Gerade da, wo das Buch am politischsten wirkt, ist es von privaten Emotionen durchtränkt.
Aber auch über ihre eigene Partei hält Kerckhoff Gericht. "Ich werfe es der SED vor, dass sie die Interessen der Bauern und der Stadtbevölkerung zu wenig hilfreich unterstützt ... Ich werfe der SED vor, daß sie psychologische Taktiken der UdSSR imitiert, die hierzulande sinnlos und schädlich sind." So geht das mehrere Seiten lang, gipfelnd in dem Vorwurf, die Kommunisten trügen dazu bei, dass "der Friede verloren wird". Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, wie Susanne Kerckhoff mit solchen Ansichten in den Jahren der Berlin-Blockade und der Gründung von BRD und DDR bei den Genossen immer wieder aneckte, bis sie beschlossen, die unbequeme Parteigängerin kaltzustellen. Ihr Selbstmord war die Folge eines Rufmords.
Interessanterweise ist in diesem im Jahr von Susanne Kerckhoffs Parteieintritt erschienenen Buch von den Galionsfiguren der neuen kommunistischen Kulturpolitik - etwa Stephan Hermlin oder Kerckhoffs Halbbruder Wolfgang Harich - nie die Rede. Stattdessen fallen Namen wie Erich Kästner, Günther Weisenborn oder Hans Carossa, auch Carl Schmitt und Heidegger werden genannt. Der Riss zwischen Geist und Gesinnung, der die Kultur im Kalten Krieg prägen sollte, ging mitten durch Kerckhoffs Schreiben.
Auch deshalb ist es mehr als bedauerlich, dass der vorliegende Band weder ein Personenregister noch erklärende Fuß- oder Endnoten enthält. Es ist die dritte und größte Enttäuschung dieser Neuausgabe, denn ohne ergänzende Informationen etwa zur Funktion des Kulturbunds, der später zum Herrschaftsinstrument der DDR wurde, oder zur Rolle Kästners in den Debatten der Nachkriegszeit ist dieses Buch nicht zu verstehen. Dem Herausgeber Peter Graf "Zeitgeistcamouflage" und "Gedächtnisdesign" vorzuwerfen, wie es die Publizistin Ines Geipel in der "Neuen Zürcher Zeitung" getan hat, ist dennoch übertrieben. Graf hat seine Herausgeberschaft nicht missbraucht, sondern schlicht nicht ausreichend wahrgenommen. Er hat die "Berliner Briefe" abgeschickt, als wäre ihre Absenderin allgemein bekannt.
Susanne Kerckhoff sei "keine vergessene Autorin", schreibt Graf in seinem Nachwort. Das stimmt nicht. Zwar haben sich die obengenannte Ines Geipel und weitere Germanistinnen um ihre Rehabilitierung bemüht, aber im allgemeinen literarischen Gedächtnis ist Kerckhoff nicht präsent. Ob sich das mit diesem Buch ändert, bleibt abzuwarten. Eine große Romanautorin ist in diesem hundertseitigen, mit ebenso treffenden wie schiefen Bildern ("im Herzen des Volkes aus den Pantinen kippen") gespickten Monolog jedenfalls nicht zu entdecken. Trotzdem muss man die "Berliner Briefe" bewundern. Nicht weil sie so schön, sondern weil sie so wahr sind.
ANDREAS KILB
Susanne Kerckhoff: "Berliner Briefe".
Hrsg. und mit einem Nachwort von Peter Graf. Verlag Das kulturelle Gedächtnis, Berlin 2020. 112 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main