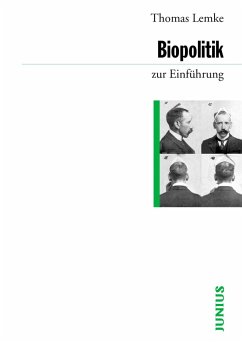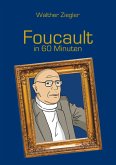Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Die Frage, mit welchen Mitteln sich der Mensch optimieren ließe, sorgt auch hierzulande für brisante politische Debatten. Ein Grund, sich den Begriff der Biopolitik näher anzusehen.
Ist das Wort "Biopolitik" eine Kampfvokabel, ein theoretischer Terminus, ein Programmbegriff, oder meint es einfach eine Politiksorte? Verdienstvollerweise hat der Hamburger Junius Verlag in seiner derzeit quicklebendigen Reihe "Zur Einführung" nun auch einen Band über Biopolitik herausgebracht. Der Frankfurter Soziologe Thomas Lemke hat sich des Themas angenommen und behandelt es in insgesamt neun Kapiteln. Diese sind ansprechend geschrieben, laden den Leser allerdings zu einer Art historisch-systematischer Kreuzfahrt ein.
Einleitend schlägt Lemke eine basale Unterscheidung vor. Er will im unübersichtlichen Feld der Verwendung des Ausdrucks "Biopolitik" "naturalistische" Konzepte (Leben als Grundlage von Politik) von "politizistischen" Ansätzen (Leben als Objekt von Politik) unterscheiden. Eigentlich enthält dieser Vorschlag schon eine These zur Sache - nämlich die Vermutung, dass es in dem zusammengesetzten Wort gerade nicht auf die Vermischung (und zwar eine gleichrangige Vermischung) beider Komponenten ankommt. Jedenfalls aber eignet sich die Unterscheidung dazu, in den ersten beiden Kapiteln einige historische Ansätze entsprechend zu gruppieren.
Lemke zieht auf der einen Seite eine Linie von der "antidemokratisch-konservativen" Politikwissenschaft der zwanziger Jahre zum Nationalsozialismus, ergänzend dazu der politikwissenschaftliche Zweig einer "Biopolitologie" seit den sechziger Jahren. Auf der anderen Seite schlägt er den Bogen von der wertkonservativen Ökopolitik der sechziger und siebziger Jahre zur sogenannten "technikzentrierten" Biopolitik. Damit meint Lemke den heutigen Gebrauch des Wortes für "administrative und rechtliche Regulierungsprozesse, die Grundlagen und Grenzen biotechnologischer Interventionen bestimmen". Eine Synthese beider Zielrichtungen (also von öko- und technikzentriertem Begriffsverständnis) sei bei dem Berliner Philosophen Volker Gerhardt gegeben - nach Lemke ist Gerhardts Ansatz ebenfalls "politizistisch" und damit zu eng.
Die nächsten Kapitel heben dann - jenseits der einführenden Unterscheidung - drei Theorieentwürfe heraus, in welchen der Begriff "Biopolitik" eine zentrale Rolle spielt. Lemke porträtiert Michel Foucaults einschlägige Überlegungen aus den siebziger Jahren sowie an Foucault anschließend "einander diametral entgegenstehende Interpretationsvorschläge": die erst wenige Jahre alten und derzeit vieldiskutierten Ansätze von Giorgio Agamben sowie von Michael Hard und Antonio Negri. In den Kapiteln, die das Dreieck Foucault, Agamben, Hard/Negri hinter sich lassen, wird es zusehends unübersichtlicher. Nun unterscheidet Lemke "vor allem in Philosophie und Gesellschaftstheorie" sowie in allgemeiner Soziologie und politischer Theorie beheimatete Ansätze von solchen, die "in der Wissenschafts- und Technikforschung" sowie anverwandten Gebieten bis hin zur "feministischen Theorie" ihren Ausgang nehmen. Unter die erste Gruppe fasst er die 1995 von Ferenc Feher und Agnes Heller in einem Buch "Biopolitik" vertretenen Thesen eines modernen Vorrangs des Körpers vor der Freiheit, den Ansatz des Soziologen Giddens, der ebenfalls in den neunziger Jahren emanzipatorische Politik von "Lebenspolitik" unterscheidet (beide Ansätze haben keinen Foucault-Bezug), sowie das Theorem der "Biolegitimität" bei dem (an Foucault geschulten) französischen Medizinsoziologen Didier Fassin. Unter der zweiten Überschrift - wir befinden uns nun in Kapitel sieben - firmieren Donna Haraway, Hans-Jörg Rheinberger und andere mit Thesen zum konstruierten Charakter der Natur, Paul Rabinows "Biosozialität" und Nikolas Roses Arbeiten zu "Ethopolitik" und "Vitalpolitik". Kapitel acht schließt dann an mit dem viel älteren Sinn von "Vitalpolitik", der sich in der deutschsprachigen Ökonomietheorie der fünfziger Jahre bei Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow findet, um dann noch weiter zurückzugehen, nämlich zu Rudolf Goldscheids "Sozialbiologie" von 1911 mit einem Konzept des "Menschenmaterials", das Lemke wiederum mit dem Humankapital heutiger Tage und also mit "Biopolitik" in einem näher zu bestimmenden aktuellen Wortsinn in Verbindung bringt.
Abschließend werden die Termini "Bioökonomie", "Biowert", "Biokapital" vorgestellt. Der Frage, wie die Politisierung des Lebens sich mit dessen Ökonomisierung verschränke, werde bisher zu wenig nachgegangen. Als "Ausblick" nennt Lemke drei Erfordernisse einer Analytik der Biopolitik. Es sollen "Wissenssysteme", die dieses Wissen mobilisierenden "Machtstrategien" und schließlich die "Subjektivierungsweisen" untersucht werden, welche die Moderne mit dem Leben verbindet.
Überzeugend ist Lemkes Zugriff vor allem dort, wo er von Foucault her die Ansätze von Agamben und Hardt/Negri ausleuchtet. Theoretisch motivierte Kritiklinien passen auch im Hinblick auf Feher/Heller oder auf die regionalen politikwissenschaftlichen Ansätze, die im Text gewürdigt werden. Foucault selbst allerdings rubriziert Lemke unter die Überschrift der Biopolitik als "Regierung von Lebewesen" und sieht bei ihm insgesamt drei Aspekte von Biopolitik: Bevölkerungspolitik, Rassismus/Thanatopolitik und die politische Ökonomie der "liberalen Regierung". Das kann man so machen - freilich handelt es sich dann um eine, sagen wir, "trendige" Akzentsetzung: Das von Foucault 1976 veröffentliche Buch zum Thema, das den Begriff "Biopolitik" im Kontext des sogenannten "Sexualitätsdispositivs" erörtert, wird auf diese Weise jedenfalls in den Hintergrund gerückt - zugunsten zweier neuerdings publizierter Vorlesungen, die das Staatsproblem und Formen des politischen Regierens (sogenannte "Gouvernementalitäten") behandeln.
Schwieriger nachvollziehbar und im Grunde etwas hilflos wirkt die historische Sortierarbeit. Man sieht die Bäume, aber es fehlt der Wald. Die vorgestellten Kontexte werden kaum gegeneinander gewichtet - so stehen apokryphe "biopolitologische" Positionen neben den aggressiven "Biopolitics" des lebenswissenschaftlich grundierten Public-Health-Regimes heutiger Tage, die Ökobewegung wird wenig plausibel einbezogen, der christliche Lebensschutz (seit der päpstlichen Enzyklika Humanae Vitae 1968 mit der Biologie versöhnt) fehlt als Kontext völlig, was begriffsgeschichtlich wie politisch unverzeihlich ist. Gerade die politische Einordnung - nämlich ein Rechts-links-Schema - dient Lemke aber als Ultima Ratio, wo die epistemologische Lage unklar bleibt.
Wieso die Ökonomie mit einem eigenen Kapitel vor die Klammer gezogen wurde, versteht man schon deswegen nicht, weil sowohl Foucault, Agamben, Hardt/Negri als auch Lemke selbst die unmittelbare Verstrickung der Ökonomiegeschichte in Begriff und Sache der Biopolitik betonen. Auch die historische Diagnose hat Schwächen. Lang vor Kjelléns "Biopolitik" (1920) gab es Schallmeyers "biologische Politik" (1905), und wenn von Kohls "Staatsbiologie" (1933) erwähnt wird, sollte Schallmeyers "Nationalbiologie" (1905) nicht fehlen. Das Kompositum aus "Biologie" und "Politik" entsteht um 1900, nicht erst in der Zwischenkriegszeit.
Bleibt die in der Tat schwierige Frage: Welcher Biopolitikbegriff ist wie relevant für die gegenwärtige Diskussion? Wahrscheinlich ist es ein unwillkürlicher Mechanismus der Komplexitätsreduktion, dass in Lemkes Einführung anstelle der vielfältigen kontinentalen Debatten der letzten Jahre fast ausschließlich die in der englischsprachigen Hemisphäre derzeit angesagten Diskussionsbeiträge behandelt werden. Warum Giddens, Rabinow und Rose, nicht aber Serres, Sloterdijk und Sarasin? Das erfährt man nicht, und der Effekt ist misslich. Was fehlt, sieht bekanntlich keiner - und so werden nicht alle Leser dieser Einführung merken, dass bei Lemke gegen Ende eine bestimmte als aktuell empfundene sozialwissenschaftliche Perspektive gegenüber denjenigen etwa der Philosophie oder der Geschichtswissenschaft recht eindeutig den Vorzug erhält.
Dem Hang zu Theorieimporten und einer Versozialwissenschaftlichung des Themas wird das Vorschub leisten. Nichtsdestotrotz: Dieses Buch zur Biopolitik schlägt als Versuch einer Begriffsklärung eine wichtige und für künftige Diskussionen erfreuliche Schneise.
PETRA GEHRING
Thomas Lemke: "Biopolitik zur Einführung". Junius Verlag, Hamburg 2007. 171 S., br., 12,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH