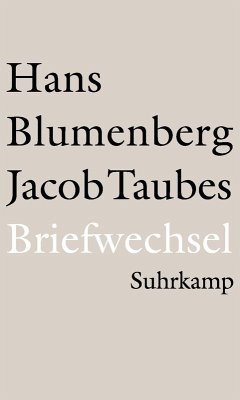Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Der eine schreibt ein Buch nach dem anderen, der andere liest und liest. Und am Ende gibt es eine Leiche ohne Mord. Der Briefwechsel zwischen den Philosophen Hans Blumenberg und Jacob Taubes liest sich wie ein geistesgeschichtlicher Kriminalroman aus der alten Bundesrepublik
Wenn es ein Zeichen von epochaler Geltung in der Neuzeit gibt, an dem man nicht vorbeikommt, ist es die endgültige Rechtfertigung der Tatsache, dass man den Fluss nur versteht, wenn man mit dem Strom schwimmt. Nur wer mit dem Strom schwimmt, gewinnt die "naturgemäßen" Erkenntnisse des Flusses, die es einem gestatten, die Eigenmacht der Wirklichkeit des Flusses zu bezwingen. Man muss sich den Gesetzen und der Macht der Natur unterwerfen, um sie aus sich selbst heraus zu beherrschen.
Wer gegen den Strom schwimmt, heißt das auf der anderen Seite, beweist nichts, außer vielleicht sich selbst. Aus seinem selbsterschöpfenden Akt spricht keine Stärke, sondern nur die Schwäche, dem Lauf des Flusses nicht einsichtig zustimmen zu können. Das ist die erkenntnistheoretisch durchgesetzte Lage in der wissenschaftlichen Welt, als der Briefwechsel zwischen den Philosophen Hans Blumenberg und Jacob Taubes 1961 beginnt. Für Philosophen kommt nun noch hinzu, dass die Philosophie gerade in der Figur eines ihrer herausragenden Vertreter im 20. Jahrhundert, Martin Heidegger, beim Schwimmen mit dem Strom einen brutalen Schiffbruch hingelegt hatte. Heideggers hemmungslose Parteinahme für die Nationalsozialisten lässt sich wie eine grausame Karikatur der (natur-)wissenschaftlichen Prämisse vom Schwimmen mit dem Strom lesen. Heidegger hatte tatsächlich geglaubt, sich durch sein Mitmachen in die Position eines geistigen Führers der Nazibewegung manövrieren zu können, der die neuen Herren dann schon lenken würde.
Ein Irrglaube, dem Hans Blumenberg und Jacob Taubes in diesem Fall nicht erliegen konnten, weil sie gar nicht hätten mitmachen dürfen. Blumenberg, 1920 in Lübeck geboren, war als "Halbjuden" der Zugang zu den offiziellen staatlichen Institutionen verwehrt. Vor der Internierung und wahrscheinlichen Vernichtung bewahrten ihn zum Ende des Dritten Reichs private Interventionen unter anderem durch die Familie seiner späteren Frau, die ihn versteckte. Und Taubes hätte als Sohn des Oberrabiners von Zürich in Nazideutschland nie auch nur die geringste Chance gehabt.
Für beide, Taubes wie Blumenberg, stellte sich die Sache mit dem Strom von Anfang an anders dar denn als bloße Entscheidung zwischen dem Mit- oder Dagegen-Schwimmen. Sie wussten um die existentielle Möglichkeit des radikalen Ausschlusses mit tödlichem Ausgang. Und dass es sich dabei um ein Wissen handelt, das seine Träger auf ganz unterschiedliche Art gefährden kann, davon handelt dieser Briefwechsel auch. Deshalb liest er sich streckenweise wie ein geistesgeschichtlicher Kriminalroman. Es handelt sich hier um eine Freundschaft, die an einem sehr dünnen Faden versucht, über sehr dünnes Eis zu gehen. Dieser Faden ist der ewige Anspruch der Philosophie, die Wahrheit zu suchen und auszusprechen. Das Eis sind die Verhältnisse in West-Deutschland im Allgemeinen und die sich immer mehr in immer neue Fachgebiete aufspaltende Wissenschaftslandschaft, die nach der Naziperiode wieder internationalen Anschluss sucht. In die Unruhe um die mangelnden internationalen Kontakte in der bundesrepublikanischen Geisteswissenschaft bricht Jacob Taubes Anfang der sechziger Jahre wie ein Wirbelwind ein.
Als Professor an der Columbia-Universität in New York, wo Taubes auf dem Weg von Zürich über Jerusalem gelandet war, beginnt er, sich über Gastprofessuren an der FU in Berlin zu etablieren. Ständig unterwegs zwischen New York, Paris und West-Berlin, saugte er dabei alles an Wichtigem und Nebensächlichem, an Klatsch, Intrigen und neuen Themen wie ein Schwamm auf. Zurück in Deutschland behält er das Aufgesaugte nicht für sich, sondern versprüht es in alle Richtungen. Er wird neben Jürgen Habermas Mitbegründer der Theorie-Reihe bei Suhrkamp und bringt andauernd Autoren wie Michel Foucault, Pierre Bourdieu oder den Islamforscher Henry Corbin ins Gespräch, die in Deutschland in den sechziger Jahren keiner kannte. Auch Blumenberg, der zu der Zeit begann, im Widerstand gegen die Resignation der geistigen Spezialarbeiter vor der Wahrheit eine interdisziplinäre Forschungsgruppe aufzubauen, die heute unter dem Namen "Poetik und Hermeneutik" legendär geworden ist, profitierte davon. Es sei einer gekommen, "wie gemacht zur Intersubjektivität und dann zur Interdisziplinarität", notierte Blumenberg, und habe seine Forschungsgruppe mit "mitgebrachter US-Hermeneutikfrische" versorgt. Es sei nie ganz falsch gewesen, einen Autor kennenzulernen, weil Taubes ihn schon kannte. Und, fügte Blumenberg hinzu, "es war für keinen ein Nachteil, von JT in eine seiner zahlreichen Verbindungen hineingezogen zu werden, die gelegentlich mit Verlegerlebensgefährtenschaften endeten". Diese Sätze gehören zu Notizen, die Blumenberg 1987, kurz nach Taubes' Tod, für einen nie veröffentlichten Nachruf machte. Die Notizen aus dem Nachlass beschließen den Briefband, und sie hinterlassen - entgegen den hier zitierten Sätzen - den Eindruck, es sei eine lang unterdrückte Aggression zum Ausbruch gekommen. Taubes habe sich dem Problem, dass mit der Kritik irgendwann auch mal Schluss sein müsste, entzogen, "indem er nichts verfertigte, was hätte kritisiert werden können", heißt es im letzten Satz. Der Krimi des Briefwechsels endet damit mit einer Leiche ohne Mord.
Bis dahin beschreibt er eine auch durch die persönlichste Anteilnahme gehende Auseinandersetzung zwischen zwei am Ende unvereinbaren Positionen. Blumenberg verfolgt bis zu seinem Tod 1996 vor allem ein Ziel: sich so einzurichten, dass er die Ruhe und den Schutz für eines der umfangreichsten philosophischen Werke des 20. Jahrhunderts für sich gewährleistet sah. Danach wählt er seinen letzten Lehrstuhl in Münster aus, deshalb wohnt er immer in kleinen Orten und organisiert seinen Tagesablauf nach dem Rhythmus seiner Schreibzeit in der Nacht. Wenn er ein Buch fertighat, beginnt er die Arbeit am nächsten. Während Taubes nach seiner 1947 erschienenen Dissertation außer gelegentlichen Aufsätzen überhaupt nichts mehr schrieb. Dafür las beziehungsweise überflog er aber alles, was ihm in die Hände geriet, und kommentierte es.
Man findet in dem Briefwechsel ein durchgehendes Motiv: Taubes will von Blumenberg jeden Text sofort bekommen, und Blumenberg möchte umgekehrt genau das Gleiche. Es kommt nur nie eine wirkliche Buchsendung von Taubes. Dafür aber kopierte Briefe, die er an andere geschrieben hat, alle möglichen Papiere zu universitätspolitischen Auseinandersetzungen in den sechziger und siebziger Jahren. Für Taubes wird das Gerangel um Posten und Institutslehrpläne zum Kampfplatz im Widerstand gegen die Verhältnisse. Andauernd sucht er aktuelle Koalitionspartner, scheut vor keiner Intrige zurück, würzt seine Aktivitäten mit messianischen Versprechen.
Blumenberg nervt das zunehmend: "Mir ist die Hektik der großen Erwartungen schon deshalb suspekt, weil sie die Wut der großen Enttäuschungen unausbleiblich machen", schreibt er 1977 mit Rückblick auf 1968. Wie um den dünnen Faden der Freundschaft nicht reißen zu lassen, mischt er unter seine Kritik an Taubes' rastlosem Leben und Denken höfliche Forderungen nach einer "eigenen, konsistenten Lebensleistung". Eine Leistung, die man nach Blumenberg nur erbringen kann, wenn man sich in ein ausgeglichenes Verhältnis zum Strom der Zeit setzte. Der Wissenschaftsgeist der Neuzeit habe mit der Metapher vom Strom, mit dem man schwimmen müsse, zwar die Naturbeherrschung impliziert, gleichzeitig aber eben auch zumindest theoretisch die Maxime ausgegeben, mit den Potentialen der Natur schonend umzugehen. Ein Akt, den Taubes, der nach einhelliger Meinung aller Zeitzeugen das Gras wachsen hören konnte, schon deshalb nicht nachvollziehen konnte, weil ihm dazu die Konstitution fehlte.
In seinen Zusammenbrüchen als "manisch-depressiv" klassifiziert, fehlte ihm der Glaube an eine friedliche Regel in der Zeit. Für Taubes konnte es, wie für Walter Benjamin, nur einen Ausstieg aus der vermessenen Welt des Menschen geben. Nur im Erkennen der weltlichen Entfremdung und "seiner Gehäuse als Verstellungen" eröffnet sich für ihn die Möglichkeit zu einem wirklich neuen, anderen Leben.
CORD RIECHELMANN.
Hans Blumenberg - Jacob Taubes: "Briefwechsel 1961-1981". Suhrkamp, 349 Seiten, 39,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main